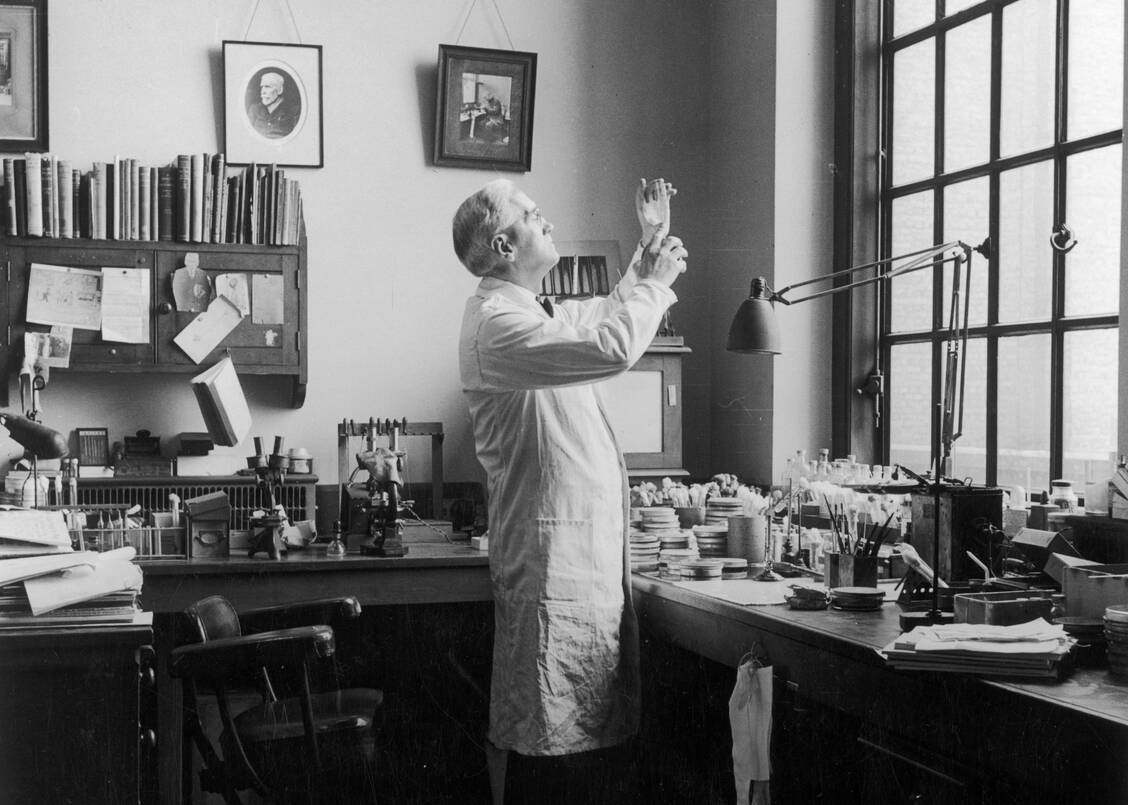Die Forschenden nutzten einen KI-basierten Algorithmus, um mehr als 1,2 Millionen Publikationen zu NIH-geförderten Projekten aus den Jahren 2008 bis 2016 darauf abzuklopfen, ob die berichteten Ergebnisse tatsächlich zu den Kategorien passten, für die ursprünglich die Förderung gedacht war. In etwa 70 Prozent der Publikationen fanden sie mindestens ein Ergebnis, das nicht dem Zweck entsprach – zumindest nicht wörtlich. Unter den Abweichungen waren jedoch auch sehr eng verwandte Begriffe, etwa »Lebererkrankung« und »Leberkrebs«. Selbst nach Aussortieren dieser nur scheinbaren Abweichungen blieben am Ende noch Anteile von 58 Prozent der Veröffentlichungen mit unerwarteten Ergebnissen und 33 Prozent der Publikationen mit unerwarteten Ergebniskategorien.