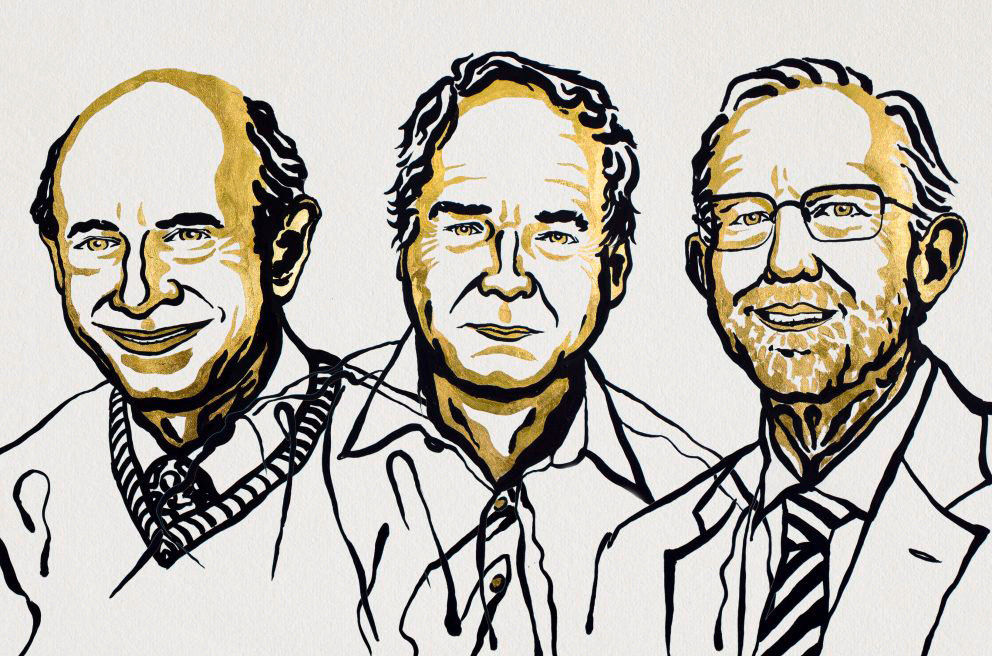In den 1960er-Jahren entdeckte Professor Dr. Baruch Blumberg das Hepatitis-B-Virus (HBV) und ermöglichte damit die Entwicklung von Bluttests auf den Erreger sowie einer Impfung. Blumberg wurde dafür 1976 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Alter, zu diesem Zeitpunkt ein Mitarbeiter der US-Gesundheitsbehörde NIH, bemerkte jedoch, dass viele Hepatitis-Fälle bei Patienten, die Bluttransfusionen erhalten hatten, weder auf HAV noch HBV zurückgingen. Er zeigte, dass sich die Lebererkrankung durch Bluttransfusionen von diesen Patienten auf Schimpansen übertragen ließ. Dem unbekannten Erreger wies Alter in weiteren Versuchen virale Eigenschaften nach und nannte die von ihm verursachte Lebererkrankung »Non-A, Non-B-Hepatitis (NANBH)«.