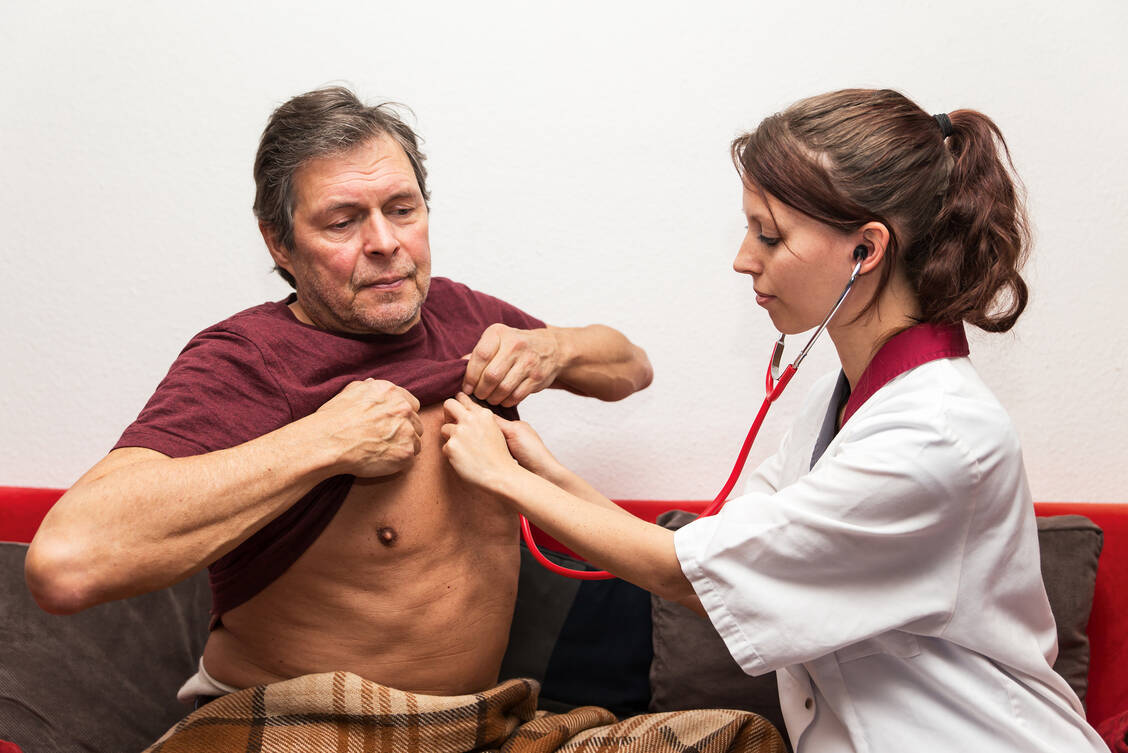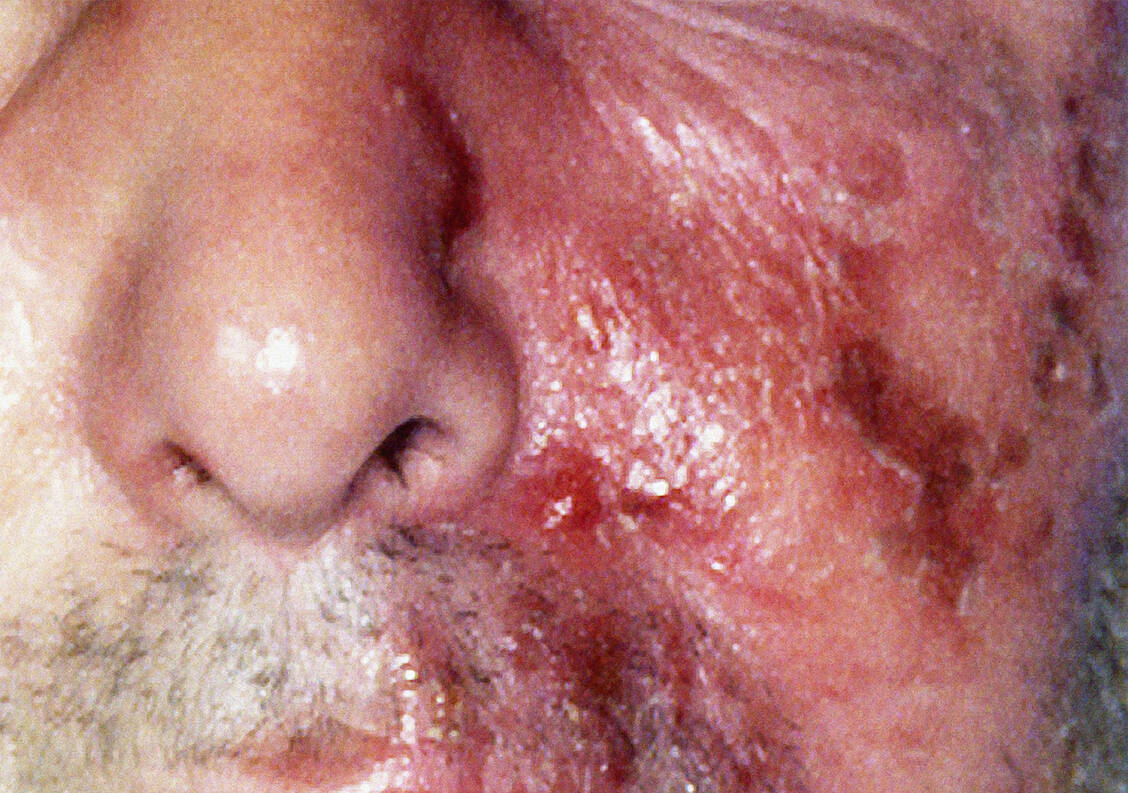1) www.antibiotic-stewardship.de
2) S3-Leitlinie »Strategien zur Sicherung rationaler Antibiotika-Anwendung im Krankenhaus«. AWMF 092/001; Update 2018.
3) Davey, P. et al., Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients (Review). Cochrane Database of systematic review 2017 Issue 2 Art. No. CD 003543.
4) European Center for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of healthcare associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm, ECDC 2013.
4a) Diamantis, P., et al., Antimicrobial use in European acute care hospitals: results from the second point prevalence survey (PPS) of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017. Euro Surveill.2018;23(46).
5) Branch-Elliman, W., et al., Association of Duration and Type of Surgical Prophylaxis with Antimicrobial-Associated Adverse Events. JAMA Surg. 2019;154(7): 590–598. DOI: 10.1001/jamasurg.2019.0569.
6) www.abda.de
7) Uranga, A., et al., Duration of Antibiotic treatment in Community acquired Pneumonia. JAMA Intern Med. 2016;176(9):1257-1265.
8) Llewlyn, M., et al., The antibiotic course has had its day. BMJ 2017;358:j3418.
9) European Center for Disease Prevention and Control. Survey of healthcare workers’ knowledge, attitudes and behaviours on antibiotics, antibiotic use and antibiotic resistance in the EU/EEA. Stockholm, ECDC 2019.
10) S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenemphysem (COPD) Stand 01/2018.
11) Holstiege, J., et al., Update: Die ambulante Anwendung systemischer Antibiotika in Deutschland 2010 bis 2018; eine populationsbasierte Studie. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Versorgungsatlas-Bericht Nr. 19/07. Berlin 2019.
12) Ewig, S., et al., S3-Leitlinie Behandlung von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie und Prävention. Update 2016. AWMF-Reg.-Nr 020–020.