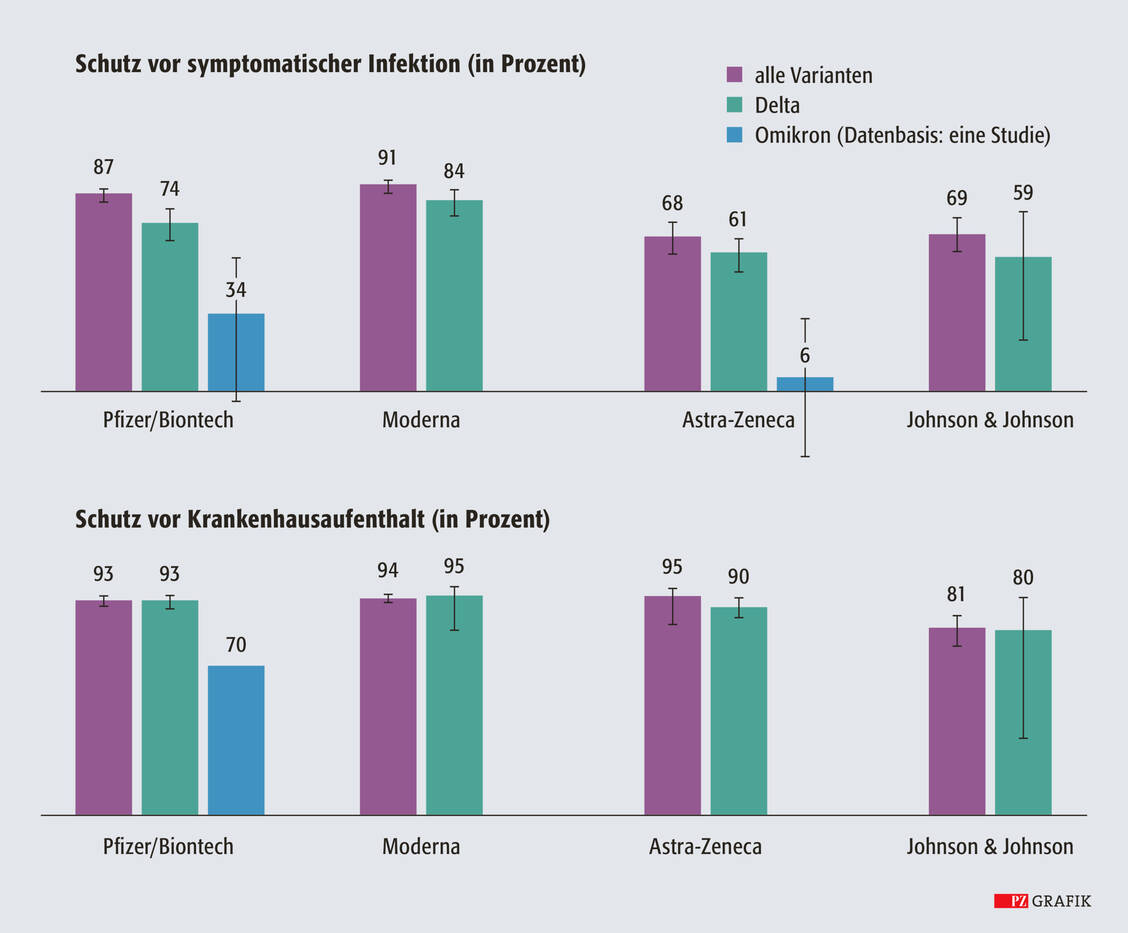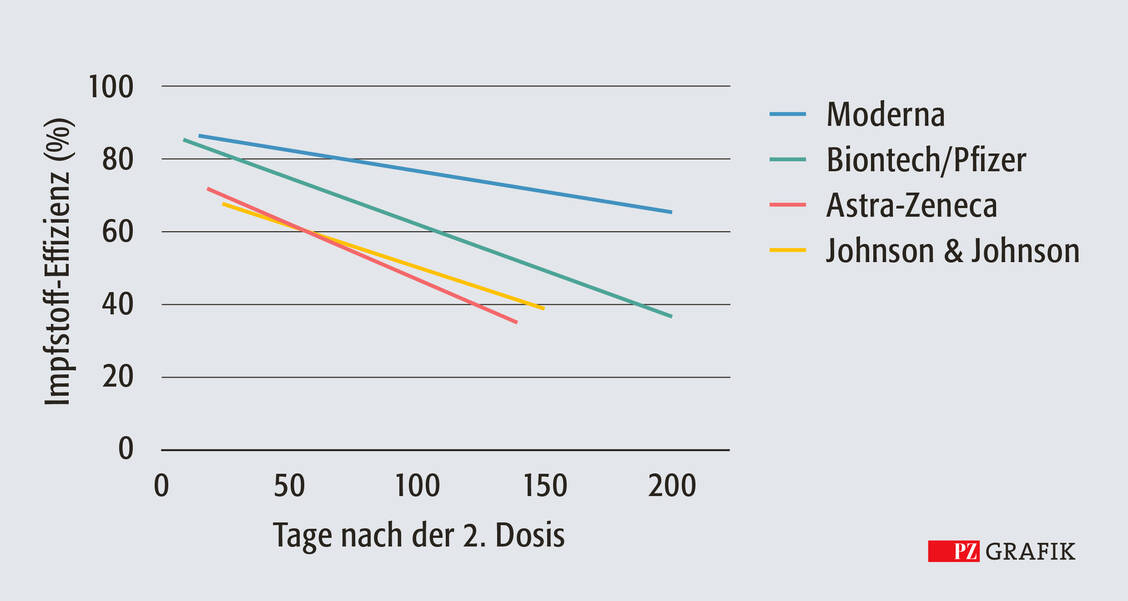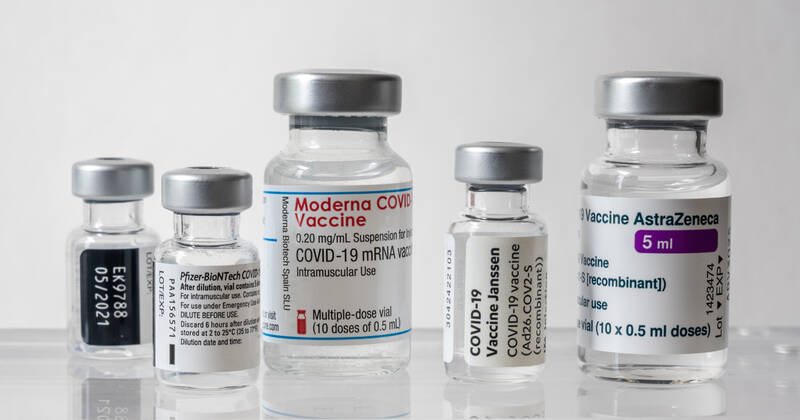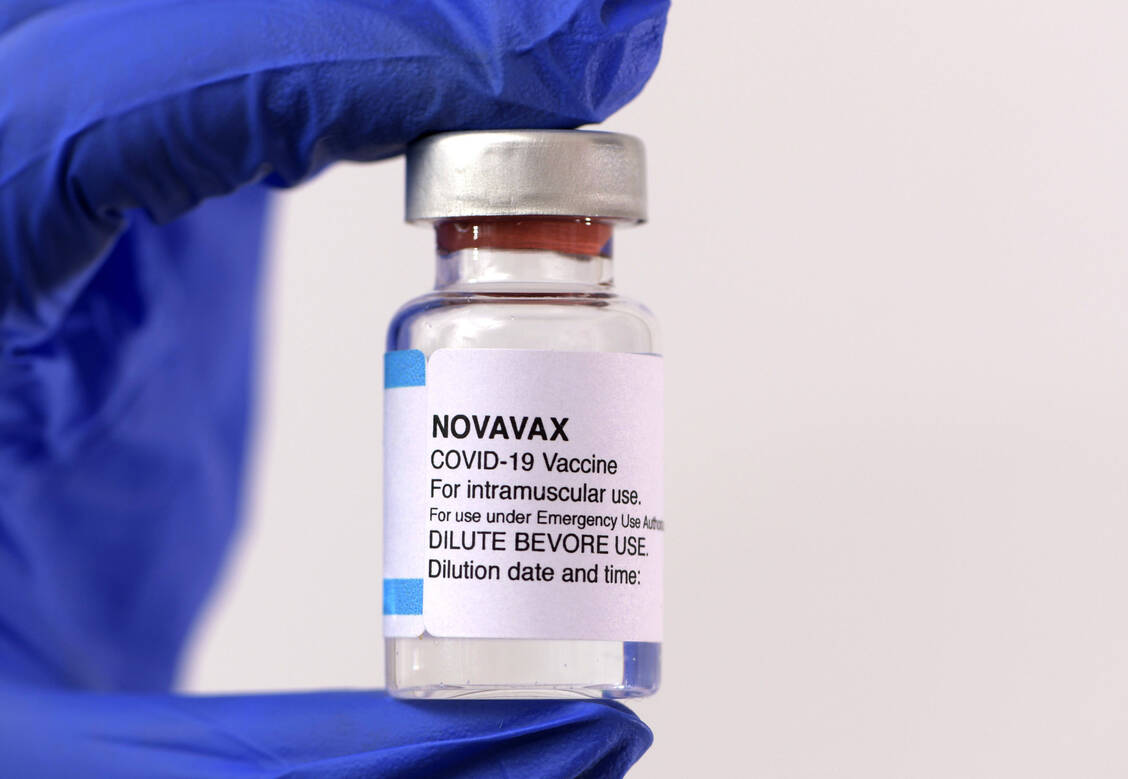Eine Kreuz- oder Mischimpfung, auch heterologe Impfung genannt, bedeutet, dass eine Person unterschiedliche Impfstoffe gegen einen Erreger erhält, sofern mehrere Impfdosen für einen vollständigen Impfschutz erforderlich sind.
So empfiehlt die STIKO etwa Personen, die mit dem Vektorimpfstoff von Janssen geimpft wurden, zur Optimierung der Grundimmunisierung eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Auch Boosterungen erfolgen unabhängig davon, mit welchem Impfstoff die erste Impfserie abgeschlossen wurde, mit einem mRNA-Präparat.
Die Kombination unterschiedlicher Impfstoffe für Erst- und Zweit- beziehungsweise Boosterimpfung ist möglich, da sich die T-Zell-basierte Immunantwort bei allen in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffen gegen das gleiche Antigen des Virus richtet. Studienergebnisse zeigen, dass die Immunantwort nach einem heterologen Impfschema deutlich besser ist als nach einer homologen Vektorimpfserie. Auch die gebildeten Antikörperkonzentrationen waren in Studien deutlich höher.