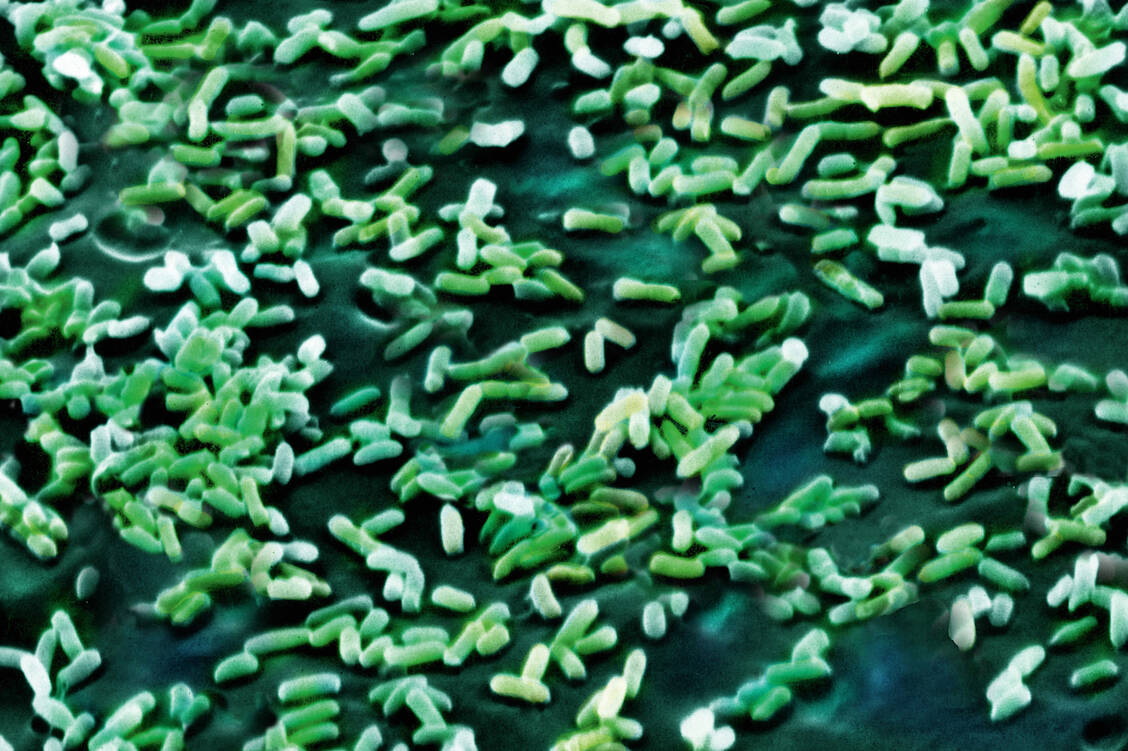Bei MRSA gebe es in Deutschland eine positive Entwicklung, so Becker. Der Anteil von MRSA an invasiven Isolaten sei von einem Höchststand mit 20,9 Prozent im Jahr 2010 auf zuletzt 7,6 Prozent im Jahr 2018 gesunken. »Dennoch dürfen wir nicht aufhören, uns um MRSA zu kümmern. Der Erreger lauert nur darauf, zurückzukehren, wenn wir mit unseren Maßnahmen nachlassen«, warnte Becker. Problematisch in diesem Zusammenhang sei, dass viele Nutztiere wie Schweine, Rinder und Pferde mit MRSA besiedelt seien. Den Antibiotikaverbrauch zu senken, habe hier meist keinen Effekt, da das MRSA-Resistenzgen auf einer sogenannten Genkassette zusammen mit einer Zinkresistenz liege – und Zink in der Schweinemast breit eingesetzt werde.