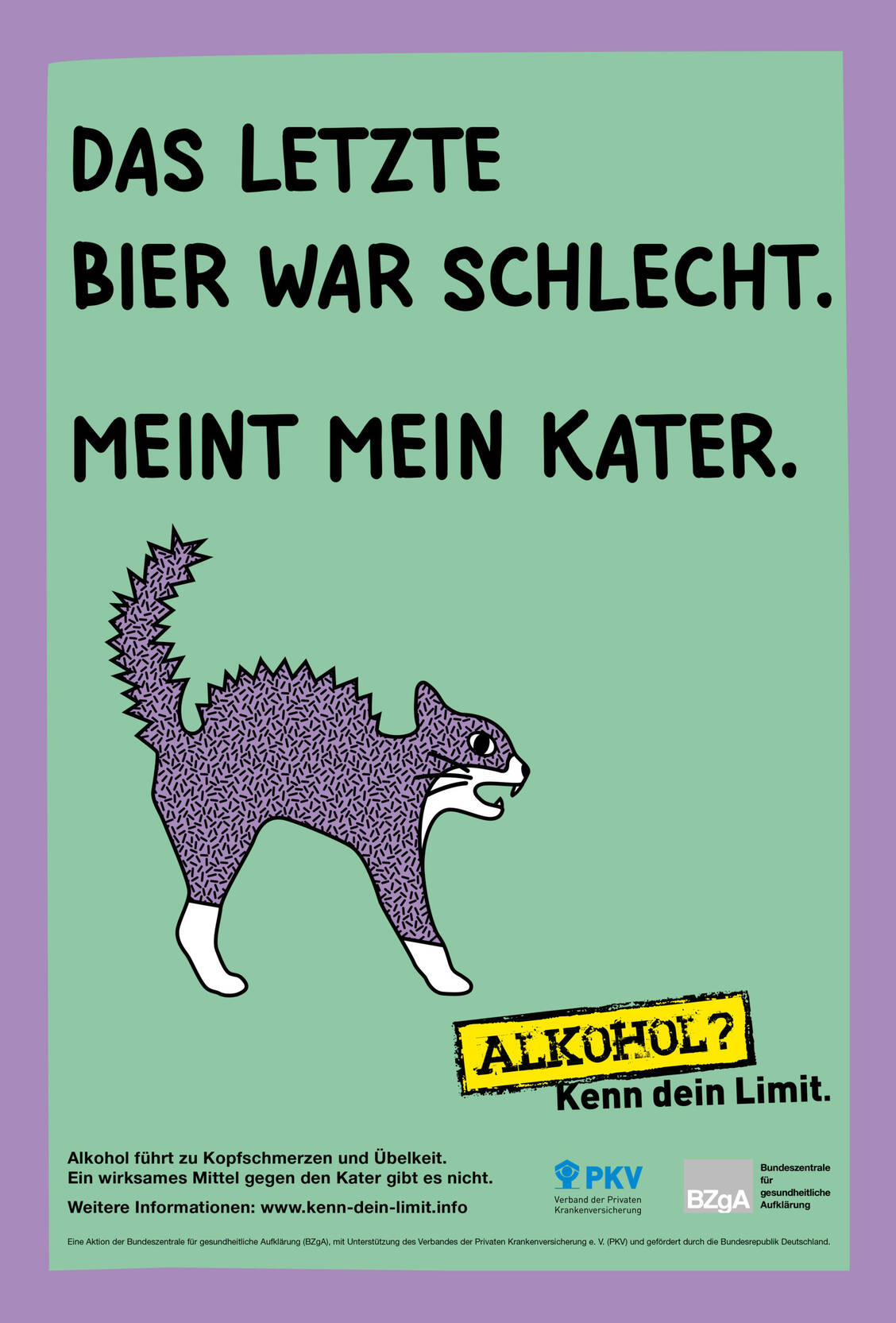Für straffe Rahmenbedingungen plädiert auch Professor Dr. Falk Kiefer vom Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit gegenüber der PZ. »Kinder und Jugendliche müssen vor dem 18. Lebensjahr konsequent geschützt werden.« In der Jugendphase sind Menschen erheblichen körperlichen und psychischen Veränderungen ausgesetzt. Auch das Gehirn unterliegt in dieser Phase einer starken Entwicklung, zum Beispiel wird abstraktes Denken erlernt und das Belohnungszentrum des Gehirns ist besonders sensibel. »Junge Menschen brauchen in dieser Phase besonderen Schutz. Wichtig ist es, Zeit zu gewinnen und den Einstieg, wenn nicht zu verhindern, dann wenigstens zu verzögern«, betont der Suchtmediziner.
Auf individueller Ebene könnten gefährdete Menschen vorab neue Interessen entwickeln und neue Dinge lernen, die Spaß bereiten, erläutert Kiefer. So könne die Verknüpfung von Genuss ausschließlich mit Alkohol nach und nach in den Hintergrund rücken. Das Belohnungssystem lerne, wieder auf mehr Reize zu reagieren als nur auf Alkohol. Anfangs müsse dies allerdings sehr bewusst erfolgen, später werde es dann mehr und mehr selbstverständlich.
»Es wäre wünschenswert, wenn wir durch gezielte Präventionsmaßnahmen auf mehreren Ebenen ebenso erfolgreich wären, den Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu begrenzen, wie dies bei Tabak gelungen ist. Das würde innerhalb einer Generation massive positive Effekte auf den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit all seinen Folgeproblemen haben«, lautet Kiefers Fazit.