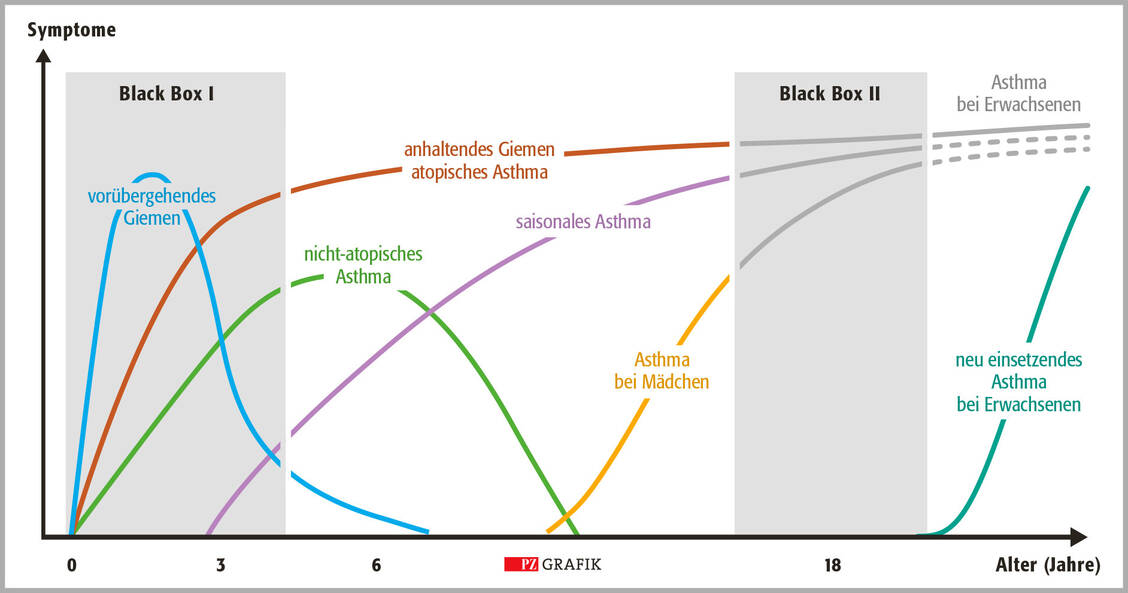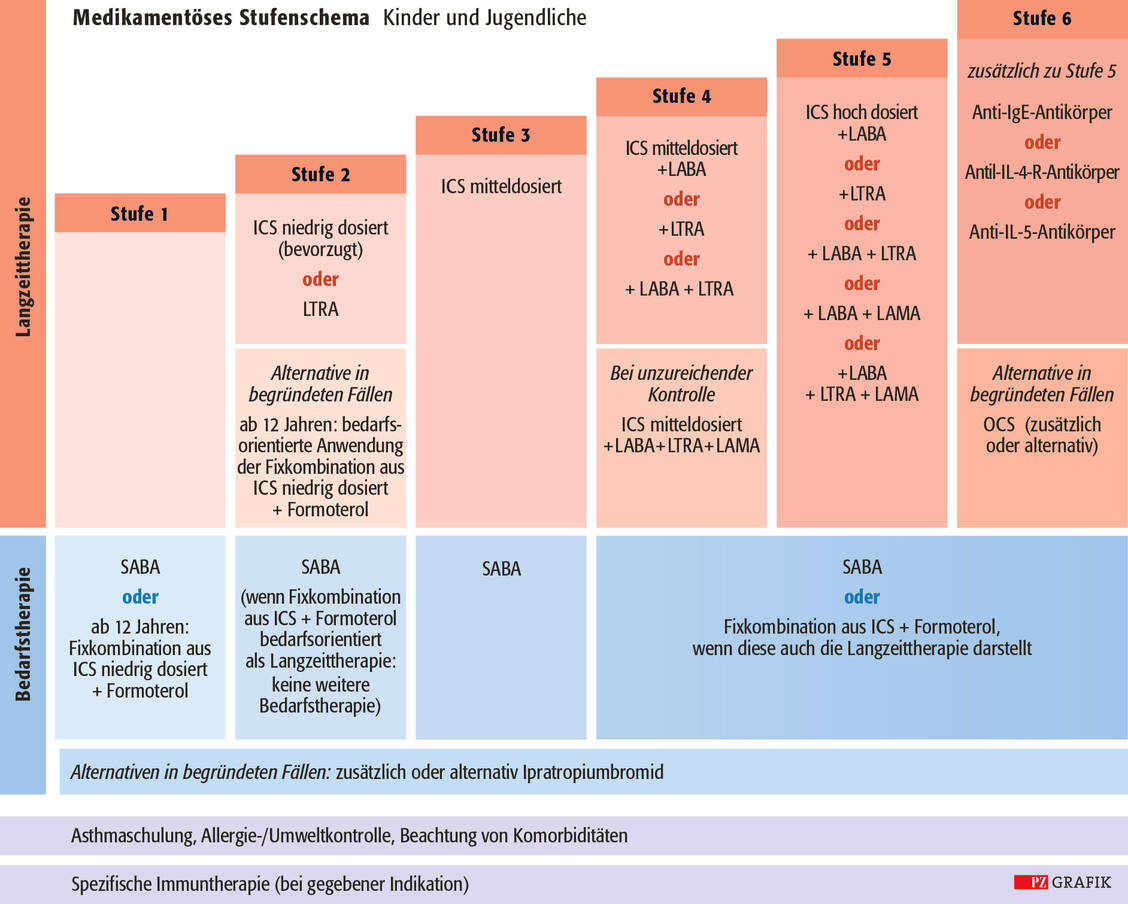Dürfen Kinder mit Asthma ein Hallenbad besuchen? Kinder würden auf Chlor sehr unterschiedlich reagieren, antwortet die Expertin. Prinzipiell sollten sie aber nicht vom Sport- oder Schwimmunterricht befreit werden.
Eine weitere häufige Frage der Eltern: Dürfen Kinder mit Asthma in den Urlaub fahren? Maison bejaht dies: Insbesondere ein Aufenthalt in den Bergen oder an der Nord- oder Ostsee sei sogar sehr günstig. In diesen Regionen könnten Kinder mit Asthma besser durchatmen.
Oft unterschätzt werden die psychischen Aspekte einer Asthmaerkrankung, die nicht nur das erkrankte Kind selbst und die Eltern, sondern oft die ganze Familie beträfen. Nicht adäquat behandelt, können die Kinder Ärger in der Schule bekommen, nicht ihre eigentliche Leistung abrufen, beim Sport am Rand stehen, sich von Mitschülern ausgegrenzt sowie unsicher und eingeschränkt fühlen. Die Kinderärztin riet, frühzeitig psychologische Unterstützung hinzuzuziehen, da die Angst vor einem Asthmaanfall den Krankheitsverlauf erheblich erschweren könne.