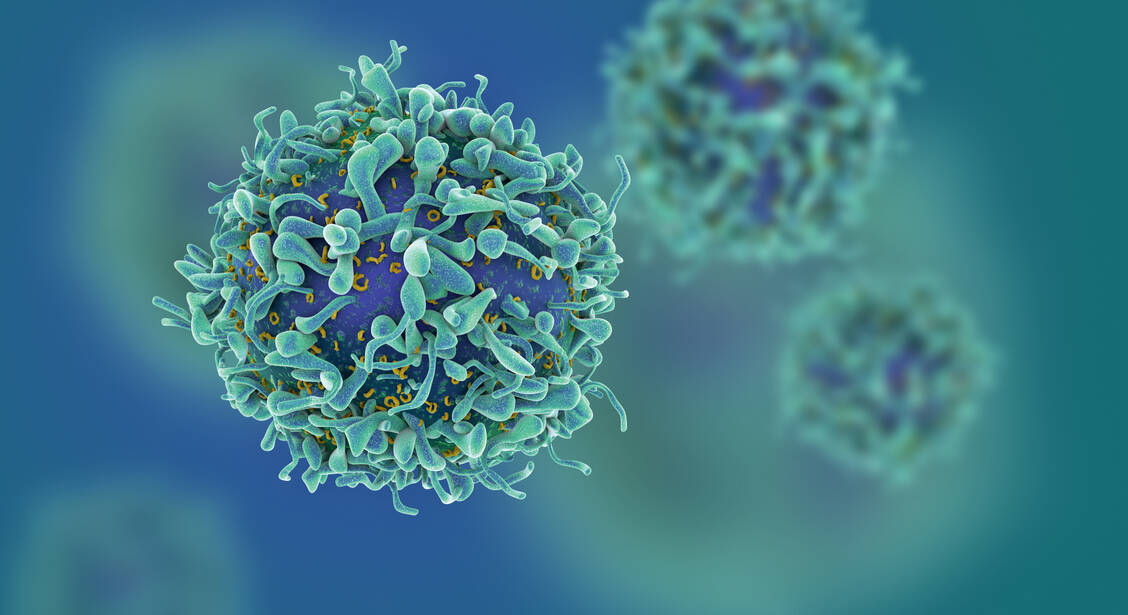Programmed Cell-Death Protein 1 (PD-1), das Target der Checkpoint-Inhibitoren, ist bei Patienten mit PML auf CD4+- und CD8+-T-Lymphozyten überexprimiert, besonders auf JC-Virus-spezifischen CD8+-T-Zellen. Somit besteht eine biomedizinische Rationale für den Einsatz der Antikörper bei PML. In der aktuellen Ausgabe des NEJM berichten nun mehrere Autorengruppen von der Anwendung eines Checkpoint-Inhibitors bei insgesamt zehn PML-Patienten. Neunmal kam Pembrolizumab zum Einsatz, einmal Nivolumab. Die Patienten, die an unterschiedlichen zugrundeliegenden Immunschwäche-Erkrankungen litten, erfuhren zum Teil eine erhebliche Besserung ihrer Beschwerden. Teilweise war die Behandlung aber auch wirkungslos (DOI: 10.1056/NEJMoa1815039, 10.1056/NEJMc1817193, 10.1056/NEJMc1816198).