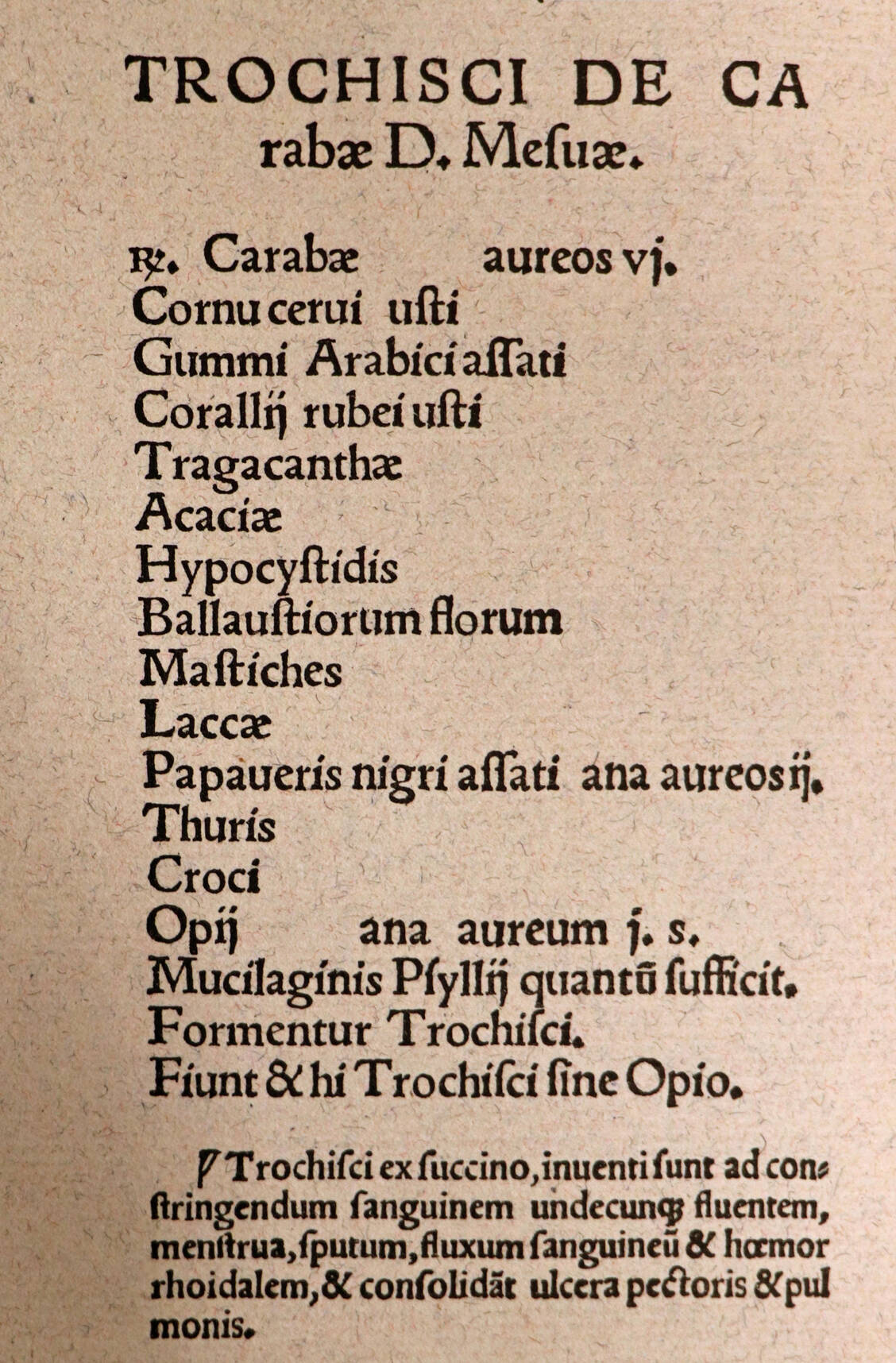Als nämlich der Halbgott Phaeton, Sohn des Sonnengottes Helios, auf seiner außer Rand und Band geratenen Fahrt mit dem Sonnenwagen vom Blitz erschlagen wurde, weinten seine Schwestern über seinen Tod so sehr, dass sie sich in (Schwarz-)Pappeln am Fluss Eridanus (den die Römer mit dem Po identifizierten) verwandelten und das tränengleich weiter an ihnen herabfließende Harz im Fluss zu Bernstein wurde. Die zweite Herleitung ist nicht mythologischen Ursprungs, aber nicht minder kurios: Der Bernstein heiße Lyngurion, Luchsstein, weil er aus dem im Sand vergrabenen erhärteten Urinstrahl des Luchses entstehe.
In der für die Pharmaziegeschichte so bedeutsamen »Materia medica in quinque libris« des Pedanios Dioskurides, die 68 nach Christus zeitgleich mit Plinius’ Naturgeschichte abgeschlossen wurde – Plinius und Dioskurides waren Zeitgenossen –, wird der Bernstein als Arzneidroge an zwei Stellen genannt. Als Lyngurion wird er folgerichtig unter den tierischen Exkreten Galle, Blut, Kot und Urin (allerdings mit dem Hinweis, dass das falsch sei und es sich dabei um den »federtragenden« Bernstein handle) eingeordnet und als Harz unter dem Stichwort Schwarzpappel mit den Indikationen Dysenterie und Bauchfluss. Dies wiederum verweist auf den Mythos von Phaeton und seinen Schwestern.