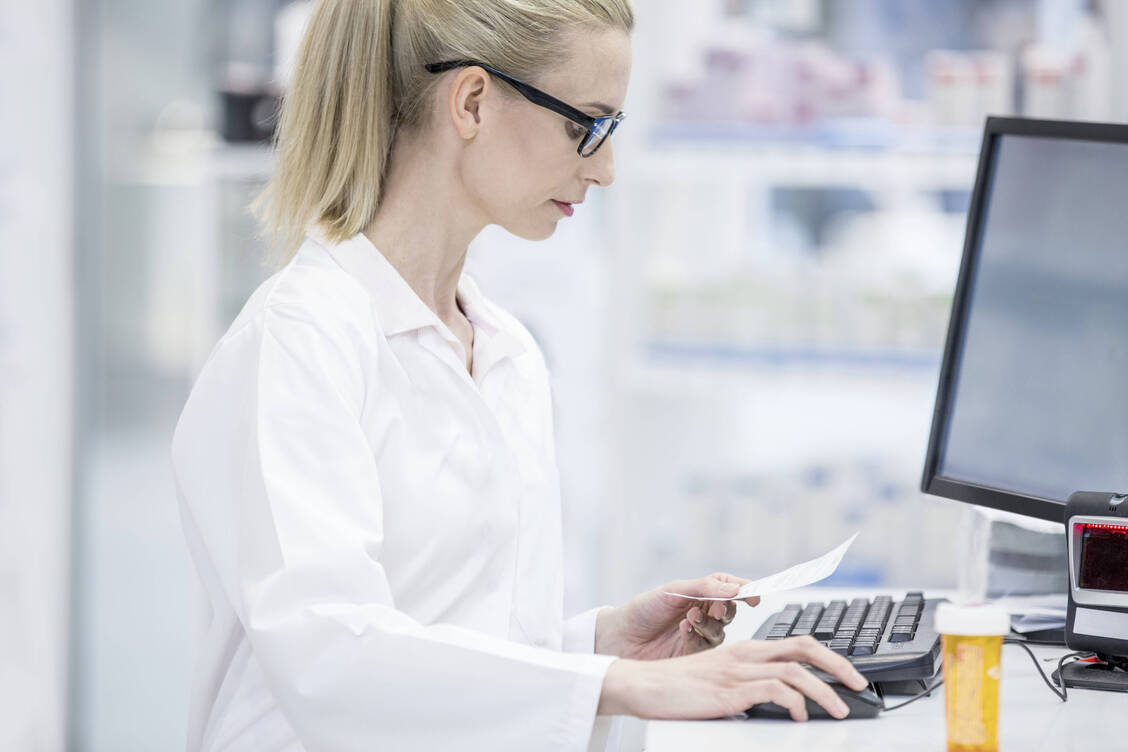Nur 64,4 Prozent der befragten Apothekerinnen und Apotheker fühlten sich ausreichend über die BtMVV-Änderungen informiert. 73,9 Prozent gaben an, noch Kapazitäten für die Sichtvergabe von Substitutionsmedikamenten an weitere substituierte Opioidabhängige zu haben. Während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 stieg der Anteil der Apothekerinnen und Apotheker, die eine Erhöhung der Anzahl von Take-Home-Rezepten angaben, auf 33 Prozent an. Ein Viertel der in die Substitution involvierten Apotheken gab an, dass Mischrezepte den organisatorischen Aufwand noch weiter erhöhen würden. Ein weiteres Viertel lehnte die Annahme von Mischrezepten gänzlich ab, so dass entweder keine entsprechenden Rezepte mehr von den substituierenden Ärztinnen und Ärzten ausgestellt wurden (13,7 Prozent) oder die Patientinnen und Patienten sich eine andere Apotheke suchen mussten (11,7 Prozent). Lediglich 2,2 Prozent fühlten sich genötigt, die Sichtvergabe nun doch durchzuführen.