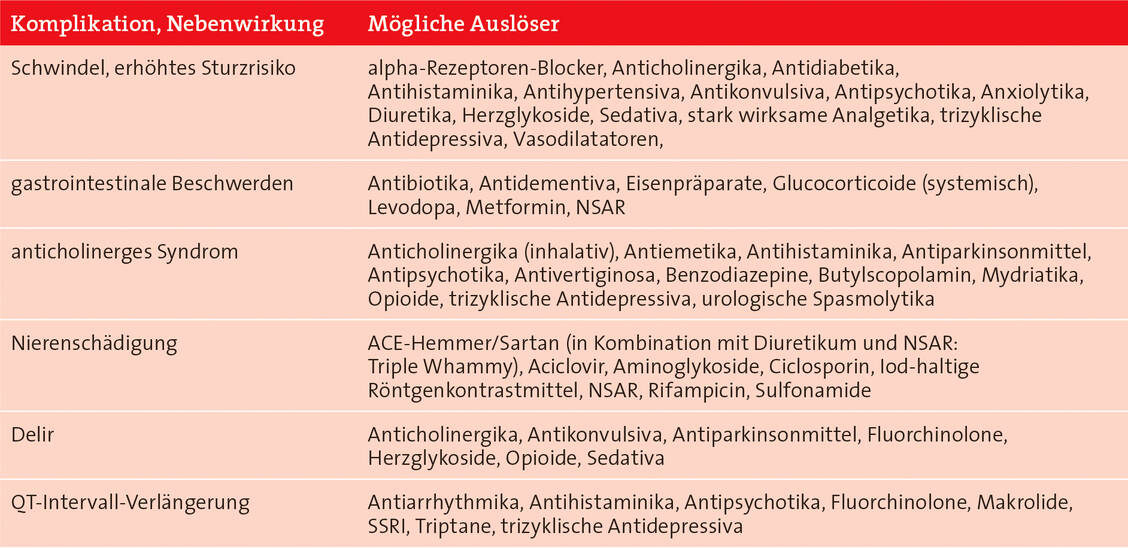Literatur
1) § 6 Berufsordnung der Apothekerkammer Berlin. Stand 16. Juni 2009 (ABl. S. 2852).
2) Wilson, O., Blanke, G., Apotheken- und Arzneimittelrecht. Loseblattwerk [Buch]. Govi Eschborn.
3) Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Gutachten 2007. www.svr-gesundheit.de/index.php?id=15
4) BAK Leitlinie »Information und Beratung des Patienten bei der Abgabe von Arzneimitteln – Selbstmedikation«, Kommentar, Stand der Revision: 23. 11. 2016. www.abda.de/themen/apotheke/qualitaetssicherung0/leitlinien/leitlinien0/.
5) Kleine, M., et al., Arzneimittelnebenwirkungen: Methoden zur Bewertung eines Kausalzusammenhangs. www.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f3/Studium/Bachelor/Bachelor_IK/bmd/Artikel/72-76_Kausalzusammenhang_Arzneimittel_Fortwengel.pdf
6) Schosser, R., Quast, U., Verdacht auf Nebenwirkungen: Medizinische Überlegungen zur Kausalität. Pharm. Ind., 1998; 60 (3) 185-191.
7) www.amts-ampel.de/publikationen. Jaehde, U, Thürmann, P., Arzneimitteltherapiesicherheit in Alten- und Pflegeheimen. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundheitswesen (ZEFQ) (2012) 106, 712-716.
8) Cocco, G., Erectile dysfunction after therapy with metoprolol. The Haxthorne Effect. Effect. Cardiology 2009, 112:174-177.
9) Zu Risiken und Nebenwirkungen – fragen Sie Ihren Apotheker! BAK-Seminar Stand 19. 12. 2017.
10) Leitlinie zur Medikationsanalyse. www.abda.de/fileadmin/assets/Praktische_Hilfen/Leitlinien/Medikationsanalyse/LL_ MedAnalyse.pdf