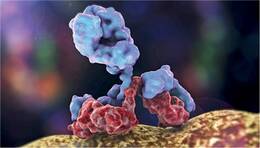Eine fundierte und differenzierte Beurteilung des Problems war bislang nicht möglich, da systematische Untersuchungen über längere Zeiträume fehlten. Diese Lücke wird jetzt durch eine großangelegte US-amerikanische Kohortenstudie geschlossen, die im Fachmagazin »JAMA Psychiatry« veröffentlicht wurde (doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.414). Elektronische Gesundheitsakten von rund 20 000 erwachsenen Patienten wurden auf einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Antidepressiva und Veränderungen des Körpergewichts hin analysiert, wobei eine Vielzahl von Wirkstoffen getrennt überprüft wurde. Die ausgewerteten Patientendaten, die klinischen und ambulanten Versorgungseinheiten entstammen, liefern ein repräsentatives Bild der Langzeiteffekte, die über ein Jahr hinweg nachvollziehbar sein mussten. Die Behandlungsdauer mit Antidepressiva betrug mindestens drei Monate. Essstörungen waren ein Ausschlusskriterium.
Citalopram als Referenz
Validierte Berechnungsmodelle, bei denen die Daten sowohl hinsichtlich soziodemografischer als auch klinischer Aspekte angepasst wurden, erlauben eine differenzierte Aussage über die Gewichtszunahme unter verschiedenen Antidepressiva. Als Referenzsubstanz diente Citalopram. Im Vergleich dazu hatten drei der überprüften Wirkstoffe einen signifikant geringeren unerwünschten Effekt auf das Körpergewicht: die trizyklischen Antidepressiva Nortriptylin (β: -0,147) und Amitriptylin (β: -0,081) sowie Bupropion (β: -0,063). Das heißt, Nortriptylin ist laut dieser Studie das Antidepressivum mit der geringsten Gewichtszunahme.
Die Autoren schlussfolgern: Antidepressiva mit geringem unerwünschtem Effekt auf das Körpergewicht sollten vor allem bei Patienten bevorzugt werden, die ohnehin zu einer Gewichtszunahme neigen. In dieser Studie war das bei jüngeren eher als bei älteren Erwachsenen der Fall, bei Männern stärker als bei Frauen. Auch Patienten mit Depressionen oder Angststörungen, die begleitend mit Antipsychotika behandelt wurden, hatten ein höheres Risiko, an Gewicht zuzunehmen. /