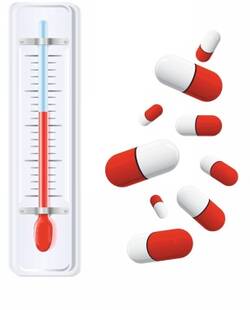Gute Chancen auf eine Marktzulassung räumt Schubert-Zsilavecz auch Crofelemer ein. Dabei handelt es sich um ein Substanzgemisch von Proanthocyanidin-Oligomeren, das aus dem sogenannten Drachenblut gewonnen wird, dem Harz bestimmter südamerikanischer Bäume. Es soll zur Behandlung HIV-/Aids-assoziierter Durchfälle zum Einsatz kommen. Wie der Referent erklärte, führen dabei zu lang geöffnete Chloridkanäle zum Einstrom großer Wassermengen ins Darmlumen. Dieser »lokale Tsunami« könne mit Crofelemer verhindert werden. Dessen antisekretorische Wirkung beruht auf der Blockade von Chloridkänalen im Gastrointestinaltrakt, zum Beispiel dem CFTR-Kanal. Dadurch wird die Wasserhomöostase sichergestellt, und weniger Flüssigkeit sammelt sich im Darm. Schubert-Zsilavecz informierte, dass ein Zulassungsantrag in den USA bereits gestellt wurde. Denkbar seien in der Zukunft auch andere Einsatzgebiete, etwa Reizdarmsyndrom und Reisediarrhö.
Mit Mirabegron könnte es zukünftig auch einen β3-Rezeptor-Agonisten auf dem deutschen Arzneimittelmarkt geben; in Japan ist die Substanz bereits zugelassen. Nachdem die Entwicklung eines β3-Rezeptor-Agonisten zum Abnehmen gescheitert ist, könnte das Krankheitsbild überaktive Blase ein neues Einsatzgebiet dieser Substanzklasse werden. Wie der Referent informierte, sind β3-Rezeptoren nicht nur im Fettgewebe zu finden, sondern werden auch im Bereich der Blase exprimiert. Dort steuern sie den Spannungszustand der Harnblase. Anders als die bei überaktiver Blase häufig eingesetzten Anticholinergika tritt unter Mirabegron nicht so häufig Mundtrockenheit als Nebenwirkung auf. Dennoch gibt es Schubert-Zsilavecz zufolge noch einige offene Fragen. So sei die Langzeitsicherheit von Mirabegron noch nicht abschätzbar. Zudem erinnerte der Apotheker daran, dass Mirabegron über CYP2D6 metabolisiert wird. Bei Poor-Metabolizern, gab er zu bedenken, könne die Plasmakonzentration vom Mirabegron deutlich ansteigen. Dadurch könne möglicherweise die selektive Aktivität an β3-Rezeptoren verloren gehen. Kardiale und Kreislauf-Probleme könnten die Folge sein, wenn zusätzlich andere β-Rezeptor-Subtypen stimuliert würden.
Sehr bald könnte es in Europa auch ein neues Antiepileptikum geben: Perampanel. Die europäische Arzneimittelagentur EMA hat Ende Mai eine positive Stellungnahme dazu abgegeben. Perampanel ist ein nicht kompetitiver AMPA-Glutamatrezeptor-Antagonist zur Behandlung von fokalen Anfällen bei Epilepsie-Patienten. Schubert-Zsilavecz erläuterte, dass Glutamat der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter sei und unter anderem an AMPA-Rezeptoren angreife. Die Aktivierung dieser Rezeptoren führt zur Auslösung exzitatorischer postsynaptischer Potenziale. Mit Perampanel kann dieser Vorgang verhindert werden.
Als weitere Arzneistoffkandidaten stellte Schubert-Zsilavecz Edoxaban, Olaparib und Vismodegib vor. Bei dem Antikoagulans Edoxaban handelt es sich um einen weiteren Faktor-Xa-Hemmer. Die zwei letztgenannten Wirkstoffe könnten für den onkologischen Bereich interessant werden. Olaparib ist ein sogenannter PARP-Inhibitor zur Therapie BRCA-positiver Krebserkrankungen. Vismodegib hemmt die Signalweiterleitung im sogenannten Hedgehog-Signalweg. Wie Schubert-Zsilavecz genauer erklärte, wirkt es als SMO-Rezeptorantagonist. In den USA ist Vismodegib seit Januar 2012 zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem Basalzellkarzinom zugelassen, das nicht durch eine Operation oder Bestrahlung behandelt werden kann.