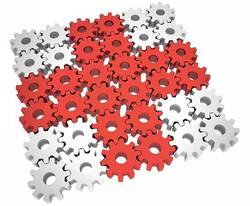Dass die Hemmung von Signaltransduktionswegen mit Kinase-Inhibitoren funktioniert, belegte Serve am Krankheitsbild der chronischen myeloischen Leukämie (CML). Vor der Einführung von Imatinib hatten CML-Patienten ein großes Risiko eine Blastenkrise zu entwickeln und dann relativ schnell zu versterben, so Serve. Unter dem Kinase-Hemmer Imatinib versterben nur 4 bis 5 Prozent der CML-Patienten. Sie müssen das Mittel allerdings lebenslang einnehmen.
Imatinib hemmt die Bcr-Abl-Tyrosinkinase. Dieses Enzym ist das Produkt des für CML-Patienten typischen Philadelphia-Chromosoms. Dieses entsteht, wenn die Enden zweier bestimmter Chromosomen gegeneinander ausgetauscht werden. Der Austausch im Erbgut hat fatale Folgen: Das Gen, das für die Tyrosinkinase Abl codiert, wird mit dem Bcr-Gen fusioniert, und die neue Kinase unterliegt nicht mehr den normalen Regulationsprozessen.
Am Beispiel von gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) zeigte der Onkologe, dass klinisches Ansprechen auf Signalinhibitoren andersherum auch das Verständnis von Krankheiten verbessern kann. Zunächst hatte man nämlich herausgefunden, dass Imatinib auch bei diesen Tumoren wirkt, und dies auf die Hemmung der Kinase Kit zurückgeführt. Allerdings sprachen auch GIST-Patienten auf Imatinib an, die keine solche Kit-Mutation aufwiesen. Erst danach fand man heraus, dass Mutationen anderer Kinasen, etwa des Enzyms PDGFα, mit GIST im Zusammenhang stehen und Imatinib auch diese Kinase inhibiert.
Serve verschwieg nicht, dass es bei GIST-Patienten auch zu sekundären Resistenzen kommen kann. Ausgelöst würden diese zum Beispiel durch spätere Mutationen der Kinasen. Der Referent stellte den Wirkstoff Sunitinib vor, der unter anderem bei Imatinib-resistenten GIST zum Einsatz kommen kann. »Es werden immer individualisierte Therapiekonzepte je nach Resistenzprofil des Tumors benötigt«, so Serve.
Im Folgenden zeigte der Mediziner am Beispiel des Lungenkarzinoms, dass klinisches Ansprechen nicht erwartet werden kann, wenn das therapeutische Target nicht gut definiert ist. Wie Serve darlegte, war dies aber bei der Entwicklung des Tyrosinkinasehemmers Gefitinib zunächst geschehen. Erst später fand man heraus, dass der Wirkstoff nur dann beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom erfolgreich angewendet werden kann, wenn die Krebszellen eine Mutation in den Genen für den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) aufweisen.
Damit eine Tumorzelle zur Tumorzelle wird, muss sie im Laufe der Zeit mehrere Eigenschaften erwerben. Dazu gehören zum Beispiel ein Signal zur Proliferation, die Induktion der Angiogenese und die Resistenz gegen Mechanismen des Zelltods. Zukünftig hält es Serve für notwendig, Kombinationen von mehreren Signaltransduktions-Inhibitoren in der Onkologie einzusetzen. Denn so könne man den Prozess der Progression gleichzeitig an mehreren Stellen blockieren und laufe zudem nicht Gefahr, dass sich Resistenzen entwickeln.
Serve zeigte sich zuversichtlich, dass in fünf bis zehn Jahren eine »ganz andere« Tumormedizin machbar ist. »Es sind die Kombinationen, die uns helfen werden, dem Patienten individualisiert zu helfen.« Um dies zu erreichen, seien auch vernetzte Versorgungs- und Studienstrukturen, der Einschluss von Patienten in Studien nach molekularen Kriterien und nicht zuletzt die sorgfältige präklinische Target-Evaluation und die Einteilung der Tumoren nach molekularen Profilen notwendig. Serve machte mit seinem Vortrag deutlich, dass individualisierte Tumortherapie bei Weitem kein bloßer Hype, sondern mit viel Hope verbunden ist.