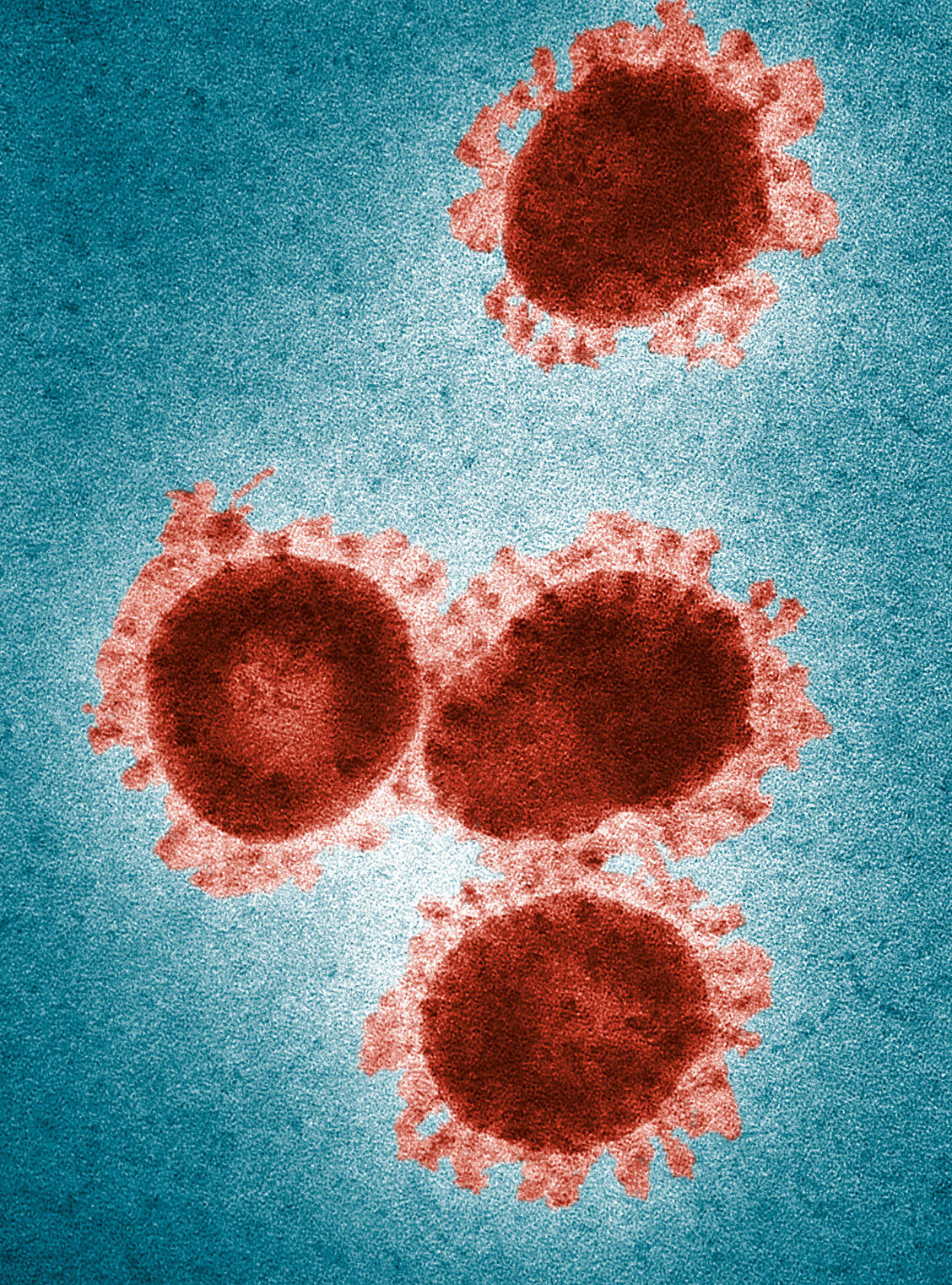In ihren Untersuchungen konnten die Wissenschaftler zeigen, dass der Autophagie-Prozess in MERS-CoV-infizierten Zellen gestört ist. Sie entdeckten zudem einen bisher unbekannten molekularen Schalter, der für den Ablauf der Autophagie wichtig ist: das Protein SKP2 (S-Phase-Kinase-assoziiertes Protein 2). Dem MERS-Virus gelingt es, diesen Schalter zu aktivieren, drosselt damit die Recycling-Maschinerie und entgeht so dem eigenen Abbau.
Daher behandelten die Forscher MERS-CoV-infizierte Zellen mit verschiedenen SKP2-Hemmern, um den Entsorgungsprozess wieder anzukurbeln. Dies war erfolgreich: Die Vermehrung des Virus wurde sehr deutlich reduziert. Positiv ist, dass sich unter den getesteten SKP2-Inhibitoren auch bereits zugelassene Wirkstoffe befinden, zum Beispiel das Bandwurmmittel Niclosamid. Auch dieser Wirkstoff war bei den Versuchen in der Lage, die Vermehrung des MERS-Erregers in den Zellen deutlich zu verringern. Die Forscher wollen nun prüfen, ob die Mittel auch gegen 2019-nCoV aktiv sind. »Für den Einsatz von SKP2-Hemmern als Medikamente fehlen allerdings noch Tests im Organismus«, schränkt Privatdozent Dr. Marcel Müller ein. Außerdem sei eine klare Risiko-Nutzen-Abwägung nötig, da auch bereits zugelassene Medikamente Nebenwirkungen haben können.