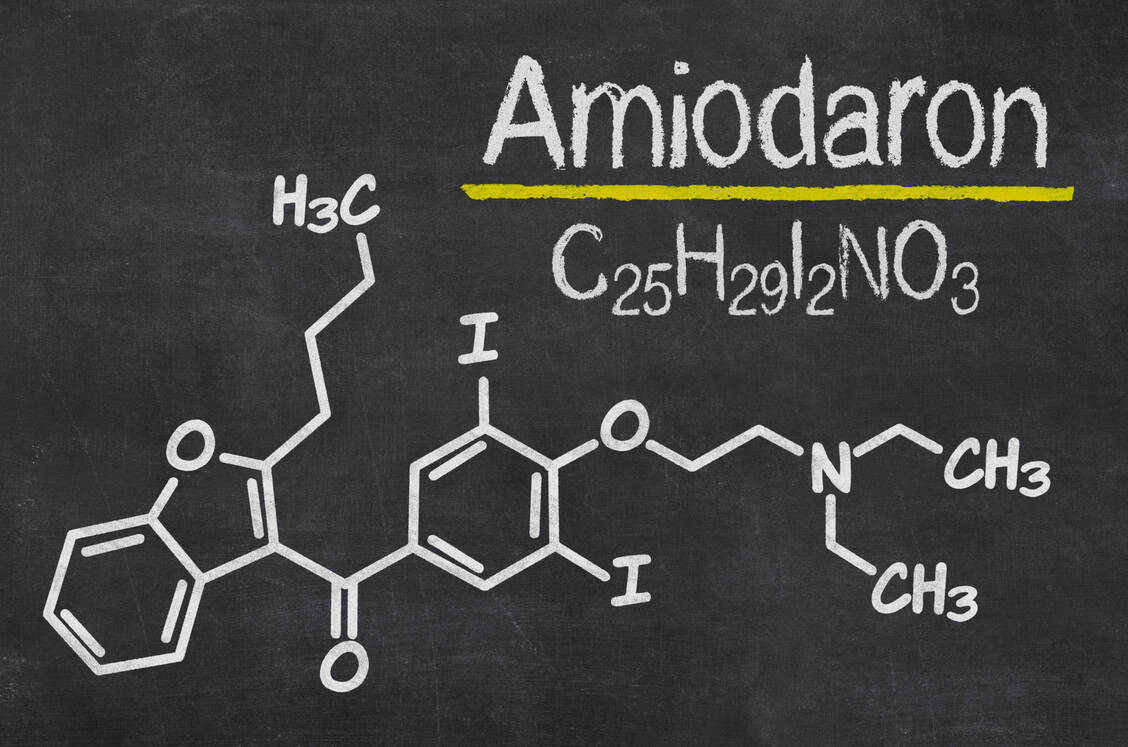Der Publikation zufolge stellte man zudem fest, dass Amiodaron die Toxine noch über einen weiteren Mechanismus hemmt. »Um ihren toxischen Anteil in das Zellinnere zu transportieren, bilden die Toxine eine Membranpore«, so Seniorautor Professor Dr. Panagiotis Papatheodorou, ebenfalls Ulm. »Unseren Daten nach hemmt Amiodaron diesen Vorgang, indem es direkt mit dieser Membranpore wechselwirkt, selbst bei TcdA- und TcdB-Varianten aus einem besonders virulenten und epidemisch auftretenden C.-difficile-Stamm.« Amiodaron könnte dem Pharmakologen zufolge eines Tages eine Begleittherapie von C.-difficile-assoziierten Erkrankungen darstellen. Dies müsse aber zunächst noch in klinischen Studien untersucht werden.