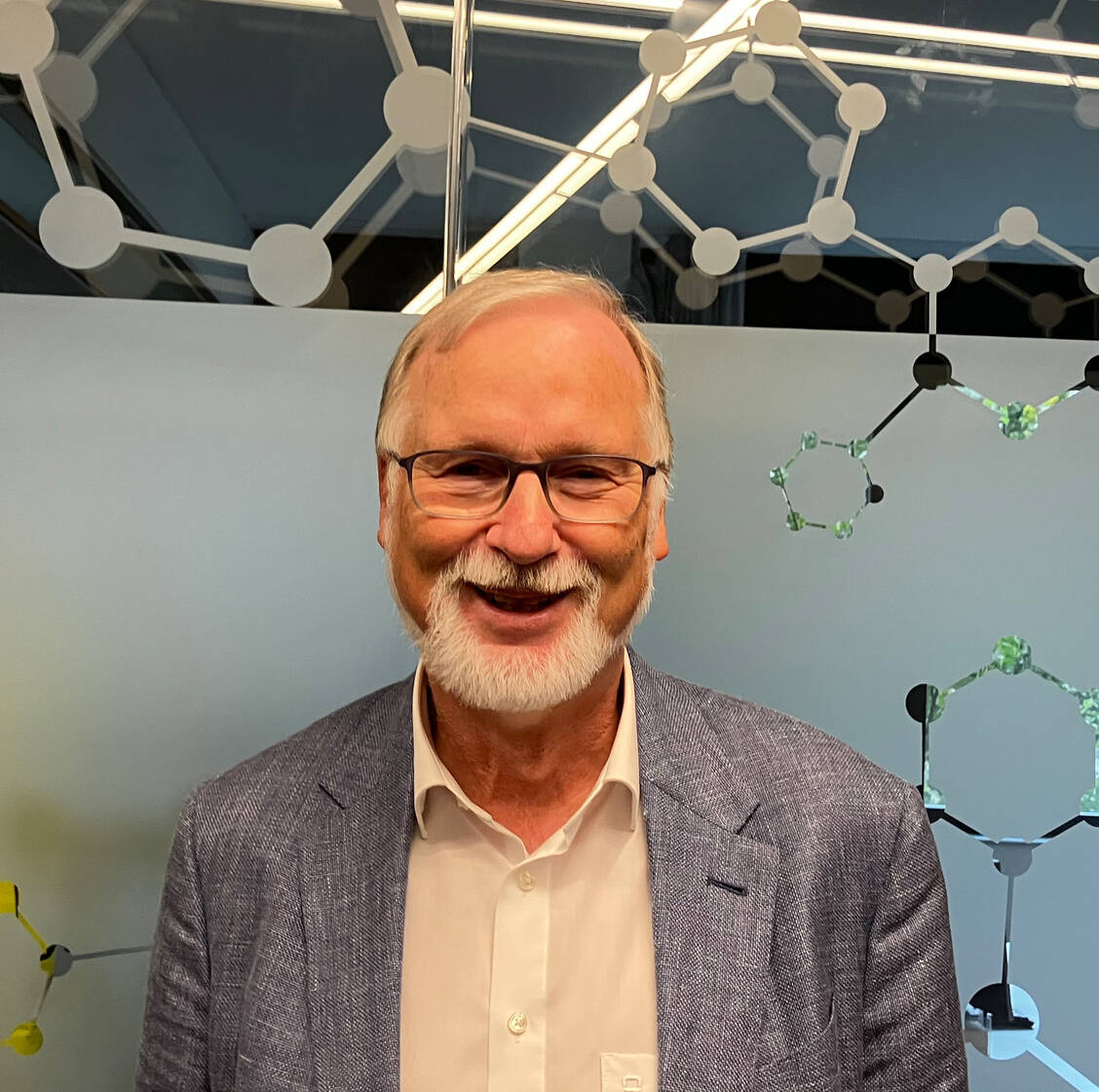Möller erklärte noch einmal die Unterschiede: Die Gesetzliche Rentenversicherung ist für abhängig Beschäftigte konzipiert und funktioniert nach Umlageverfahren, Solidar- und Äquivalenzprinzip: Was man einzahlt, wird sofort für die bestehenden Renten wieder ausgegeben. Was man später selbst erhält, soll sich an der Lebensarbeitsleistung orientieren. Die Dynamisierung ist an die Lohnentwicklung gekoppelt.
»Dieses System funktioniert gut bei stabiler demografischer Entwicklung, wie wir sie in den 1950er-Jahren mit den Babyboomern hatten«, erklärte der Apotheker, der selbst zu dieser Generation gehört. Doch schon vor 40 Jahren kippte das System und seitdem war absehbar, dass wir den Punkt erreichen, an dem viele in Rente gehen, nicht mehr einzahlen und teils relativ hohe Rentenansprüche haben, die von weniger Einzahlenden bedient werden müssen. »Man hat bislang alles vermieden, was daran etwas ändern könnte«, bedauerte Möller.