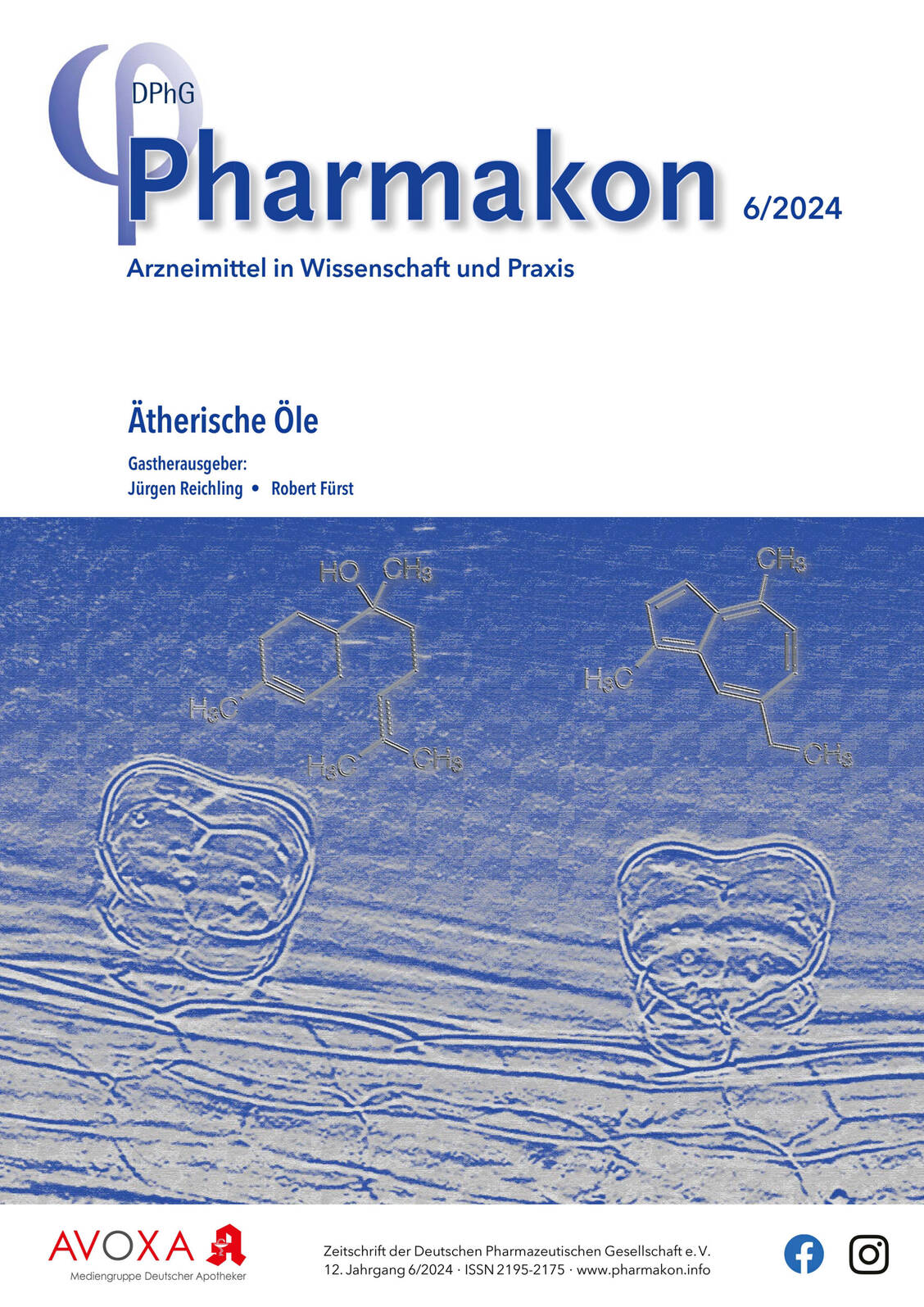Eine Eigenschaft bestimmter ätherischer Öle macht sie für den Einsatz in der Wundbehandlung besonders geeignet: Sie stören die Bildung von Biofilmen beziehungsweise unterbinden die bakterielle Kommunikation in Biofilmen (Quorum Sensing) oder töten Bakterien in Biofilmen ab. Biofilme sind organisierte Lebensgemeinschaften von Bakterien, die diese auf synthetischen oder biologischen Oberflächen bilden und in denen sie eine erhöhte Resistenz gegen Umwelteinflüsse aufweisen. Sie beeinflussen die Wundheilung negativ, insbesondere bei chronischen und infizierten Wunden.
Laut Reichling werden ätherische Öle im Management von übelriechenden Wunden, etwa bei primären Hauttumoren, Tumorexulzerationen, Metastasen oder chronischen Wunden, empfohlen und eingesetzt. Hierbei kommen nicht nur die antimikrobiellen Eigenschaften der Öle zum Tragen, sondern auch ihr angenehmer Geruch. Es gebe verschiedene Fallstudien mit positiven Daten zu Ölmischungen aus Lavendel- und Teebaumöl, teilweise auch plus Patchouliöl.