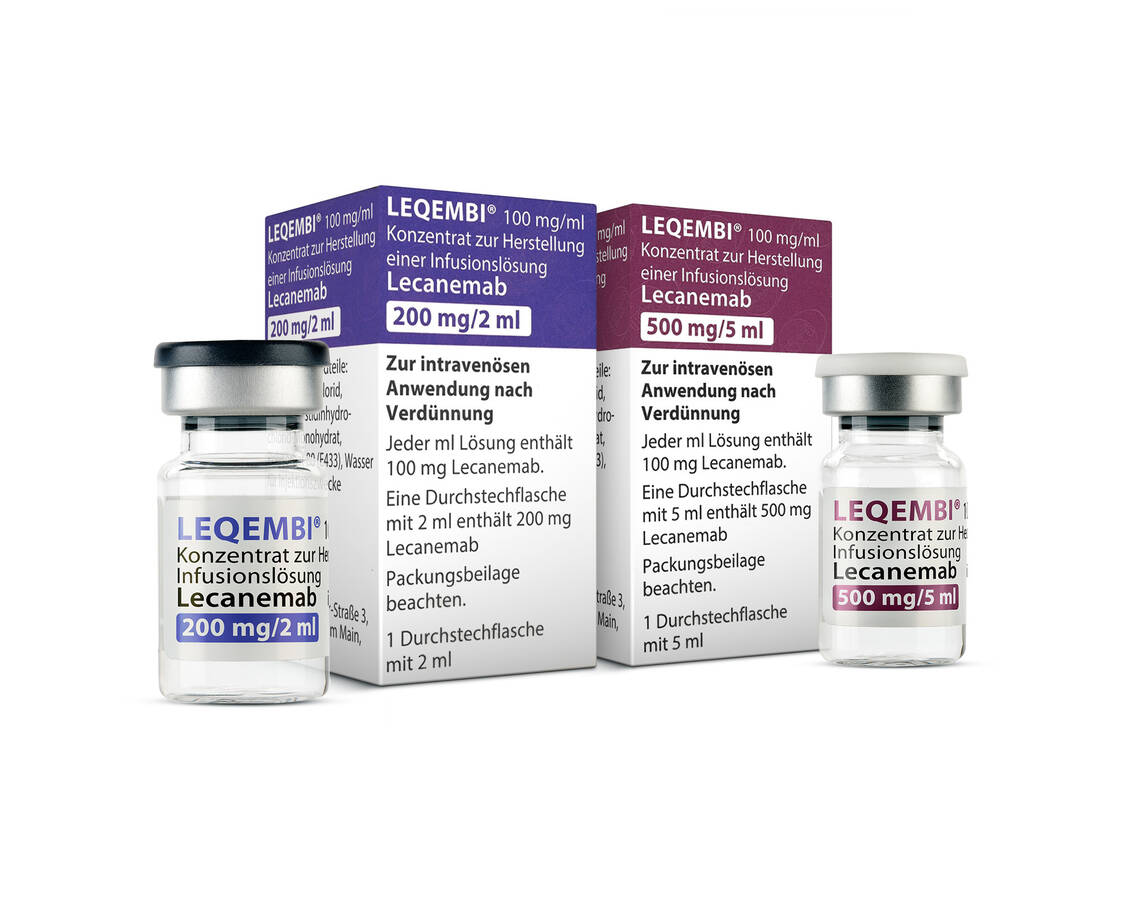Leqembi darf nur bei der empfohlenen Patientengruppe angewendet werden. Die Verschreibung ist an ein kontrolliertes Zugangsprogramm geknüpft. Das bedeutet, alle Patienten, die Leqembi erhalten, müssen in einem zentralen, EU-weiten Registrierungssystem erfasst werden. Das erfolgt über die behandelnde Arztpraxis. »Apotheken sind in dieses Programm nicht eingebunden und müssen daher hinsichtlich des Programms für den kontrollierten Zugang nichts Weiteres beachten«, teilte Eisai der PZ auf Nachfrage mit. Zugleich wird eine Sicherheitsstudie durchgeführt.
»Wir gehen davon aus, dass im Regelfall die behandelnden Ärztinnen und Ärzte direkt durch die versorgende Apotheke beliefert werden«, heißt es von Herstellerseite. Zu beachten sei, dass es sich um ein kühlkettenpflichtiges Arzneimittel handelt und Retouren nicht möglich sind.