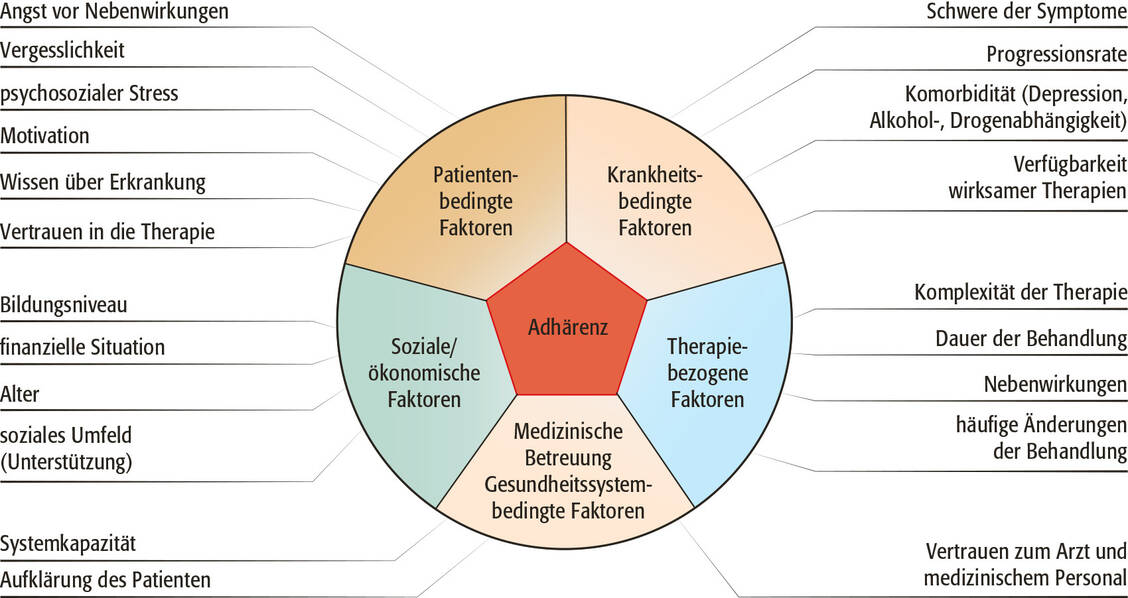Interventionen wie Patientenschulung, pharmazeutische Beratung sowie Erinnerungshilfen, zum Beispiel Cue-Dosing, Alarme, Kalender, Briefe, E-Mails, Prospekte oder Anrufe, sowie der Einsatz von Tagebüchern zum Monitoring des Therapieerfolgs gehören in diese Kategorie.
Zu unterscheiden ist: Nimmt der Patient willentlich die Medikation nicht ein oder passiert es unabsichtlich? Wenn die Entscheidung willentlich getroffen wird, gilt es, nach den Gründen zu fragen. Don’t judge! Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, da der Patient für sich »gute Gründe« hat, die es aufzudecken gilt. Meist ist es die Angst vor Nebenwirkungen. Hier kann eine pharmazeutische Beratung helfen, die Angst zu überwinden. Dies gilt auch, wenn der Patient »Horrorgeschichten« im Internet über das verordnete Medikament gelesen hat oder nicht versteht, warum das Medikament überhaupt indiziert ist. Oder er hat nach kurzer Einnahme das Gefühl, dass das Medikament nicht wirkt oder der Therapieerfolg bereits erreicht ist.