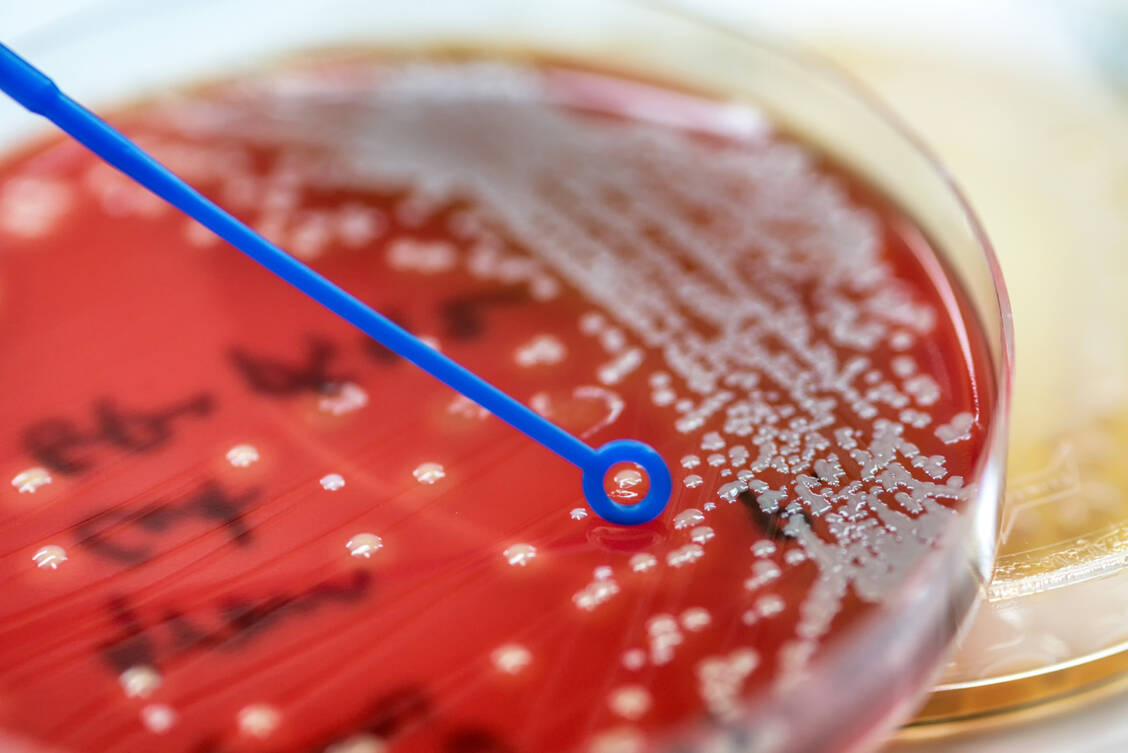Nicht immer gibt es offizielle Bewertungsstandards für die Interpretation der Daten, etwa in EUCAST, dem European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, das von 90 Prozent der Labore verwendet wird. Das gelte etwa für die Wirkstoffe Nitroxolin und Pivmecillinam, die bei ambulant erworbenen unkomplizierten Harnwegsinfekten Mittel der ersten Wahl sind. Anders als bei diesen, die vorwiegend durch Escherichia coli ausgelöst werden, kommen bei nosokomial erworbenen/komplizierten Infekten zusätzlich unter anderem Enterococcus-Subspezies infrage. Offizielle Bewertungsstandards oder standardisierte Testpanels beziehungsweise Testkarten für die automatisierte Testung stehen hier jedoch nicht zur Verfügung.