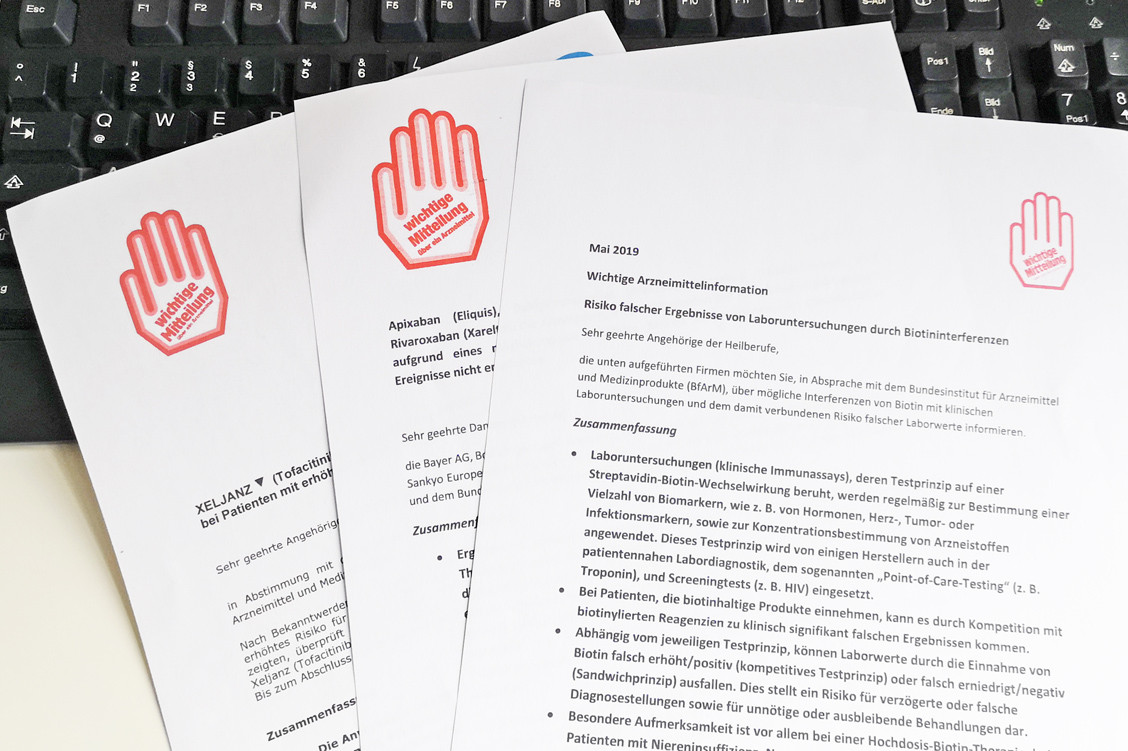Apotheker sind ein wichtiger Teil dieses Pharmakovigilanz-Systems: Sie sind dazu verpflichtet bei der Ermittlung, Erkennung und Erfassung von Arzneimittelrisiken mitzuwirken, indem sie bei Verdacht auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) oder bei Qualitätsmängeln zusätzlich der zuständigen Behörde Meldung machen. Die AMK leitet die aufgearbeiteten Berichte dann an das BfArM beziehungsweise PEI weiter, die ihre Berichte wiederum an die »Eudra Vigilance«, eine europäische Pharmakovigilanz-Datenbank, übermitteln. Auch Patienten sind dazu angehalten unerwünschte Arzneimittelwirkungen ihrem Apotheker, Arzt beziehungsweise dem BfArM oder PEI zu melden.