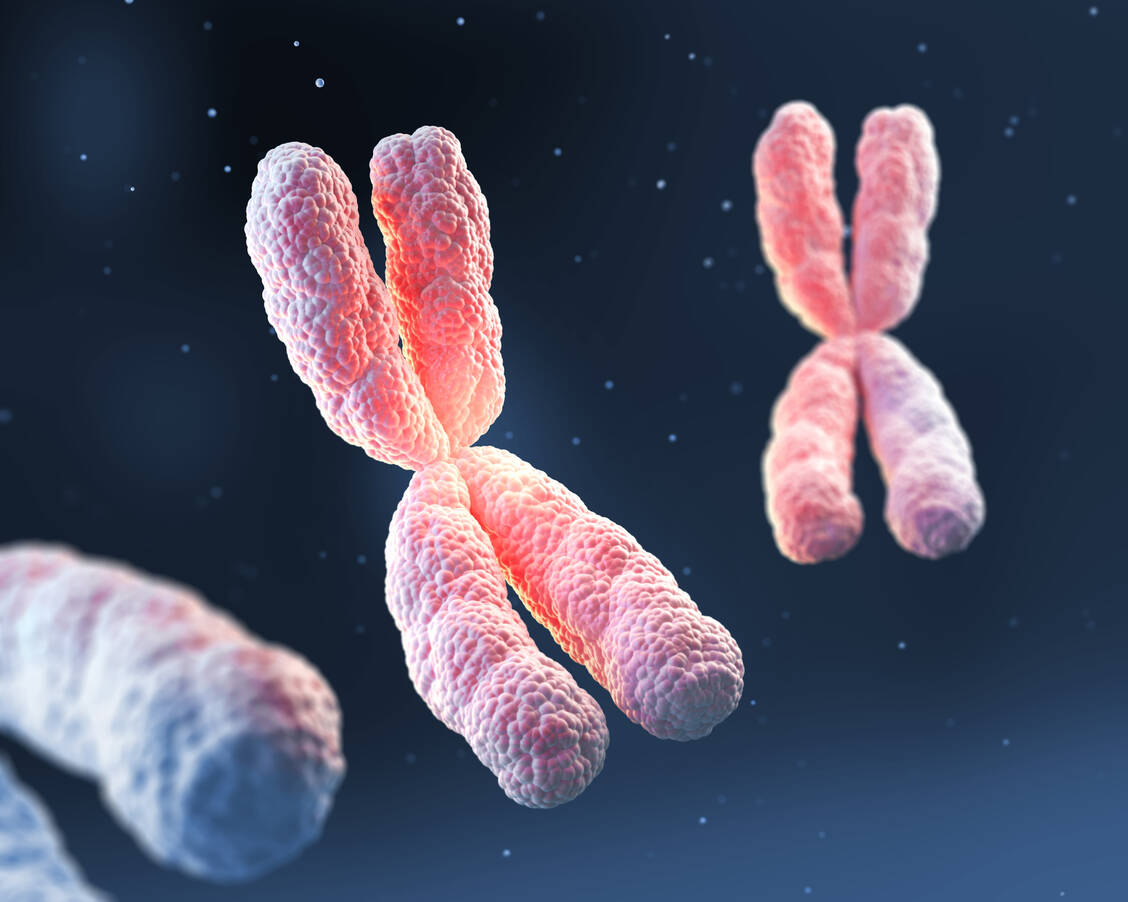Dass die Theorie mit den Hormonen auf wackeligen Füßen stand, war zum Beispiel daran ersichtlich, dass Menschen mit Klinefelter-Syndrom, die in ihren Zellen zwei X-Chromosomen plus ein Y-Chromosom (XXY) besitzen, ebenso wie gesunde Frauen ein erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen aufweisen, obwohl sie phänotypisch männlich sind und auch ein männliches Hormonmuster ausbilden. Diese Tatsache ließ Forschende aus den USA, Schweden und der Schweiz spekulieren, ob eventuell die X-Chromosomen-Dosis für das erhöhte Risiko für Autoimmunerkrankungen verantwortlich sein könnte. Dass sie mit dieser Hypothese nicht falsch lag, zeigt die Gruppe jetzt in einer Publikation in der Fachzeitschrift »Cell«. Sie identifizierte einen Ribonukleoproteinkomplex (RNP), der offensichtlich für die bevorzugte Ausprägung von Autoimmunerkrankungen bei Frauen mitverantwortlich ist.