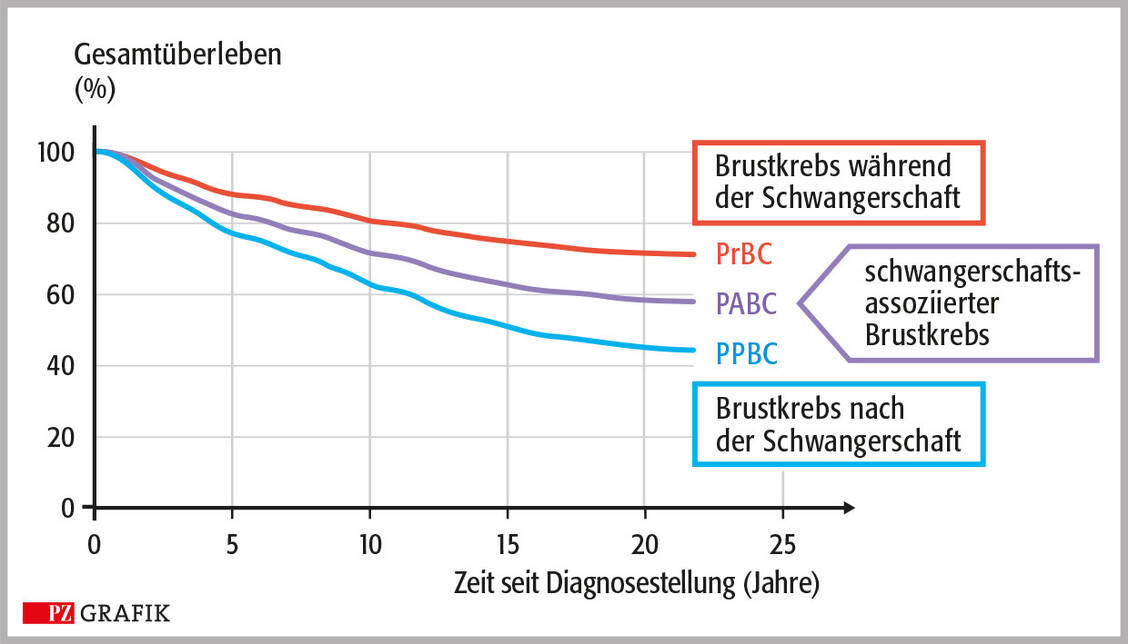Im Vergleich dazu passieren Glucocorticoide wie Dexamethason und Betamethason die Plazenta leichter und werden daher bevorzugt bei fetalen Indikationen eingesetzt. Während Dexamethason in Tiermodellen teratogene Effekte aufwies und sich in Patientenstudien ein negativer Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Fetus zumindest nicht ausschließen ließ, gilt der Einsatz von Methylprednisolon als sicher. Es sollte daher zur Anaphylaxie-Prophylaxe und Antiemese bevorzugt werden (33, 34).
Die Gabe von Granulozyten-Kolonie-stimulierendem Faktor (G-CSF) kann bei Hochrisiko-Patientinnen im Rahmen einer dosisintensiven Chemotherapie oder zur Behandlung oder Vorbeugung einer febrilen Neutropenie angezeigt sein, da diese das Überleben von Mutter und Kind erheblich bedrohen kann. Die Datenlage ist zwar limitiert, aber in retrospektiven Studien zum Einsatz von G-CSF bei schwangeren Frauen mit schweren Neutropenien zeigte sich kein nachteiliger Effekt auf den Fetus (35). Der prophylaktische Einsatz von G-CSF in der Schwangerschaft sollte weiterhin zurückhaltend erfolgen.