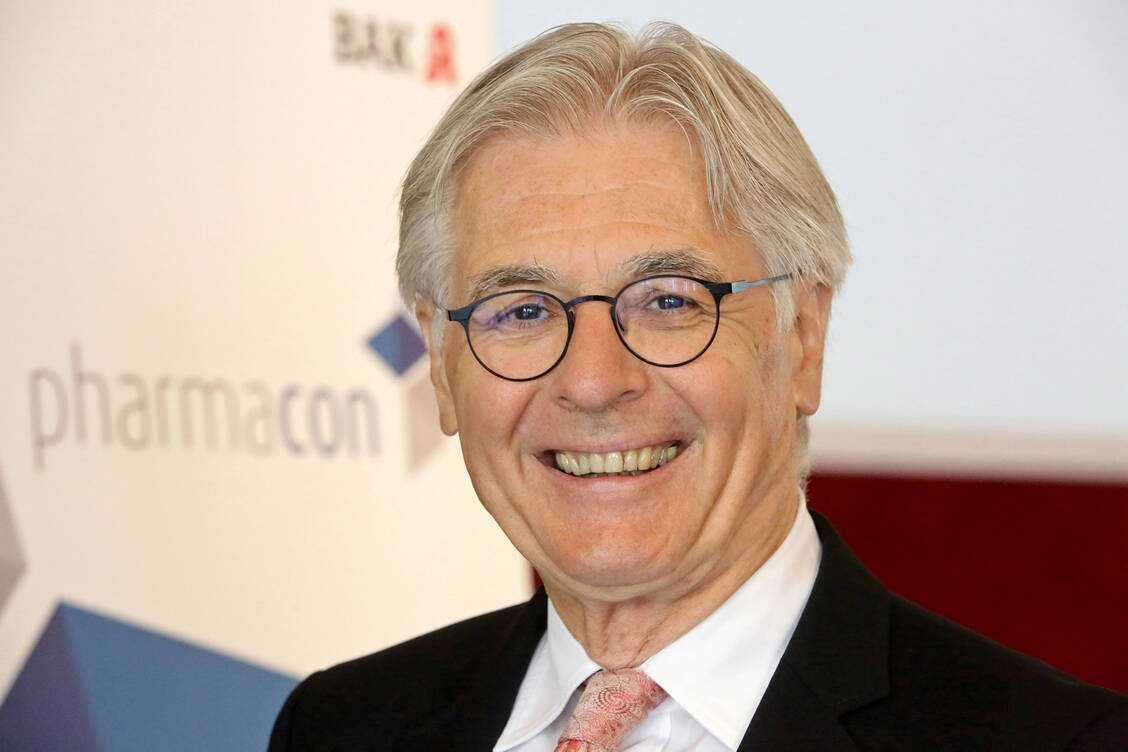Prinzipiell sei bei Impfstoffen zwischen Lebend- und Totimpfstoffen zu unterscheiden, erklärte Dingermann. Als Faustregel gelte: Totimpfstoffe seien besser verträglich, aber weniger gut wirksam, während es bei Lebendimpfstoffen genau umgekehrt sei. Immunologisch bestehe ein wichtiger Unterschied darin, dass durch die Impfung mit Totimpfstoffen lediglich die Bildung von CD4-T-Zellen angeregt werde, durch die Impfung mit Lebendimpfstoffen aber zusätzlich auch die von CD8-T-Zellen. Letztere würden auch als zytotoxische T-Zellen bezeichnet, weil sie infizierte Zellen aktiv abtöteten. CD4-T-Zellen, die auch als T-Helferzellen bezeichnet werden, können das dagegen nicht. Ihre Aufgabe besteht darin, B-Zellen dabei zu unterstützen, Antikörper zu produzieren.