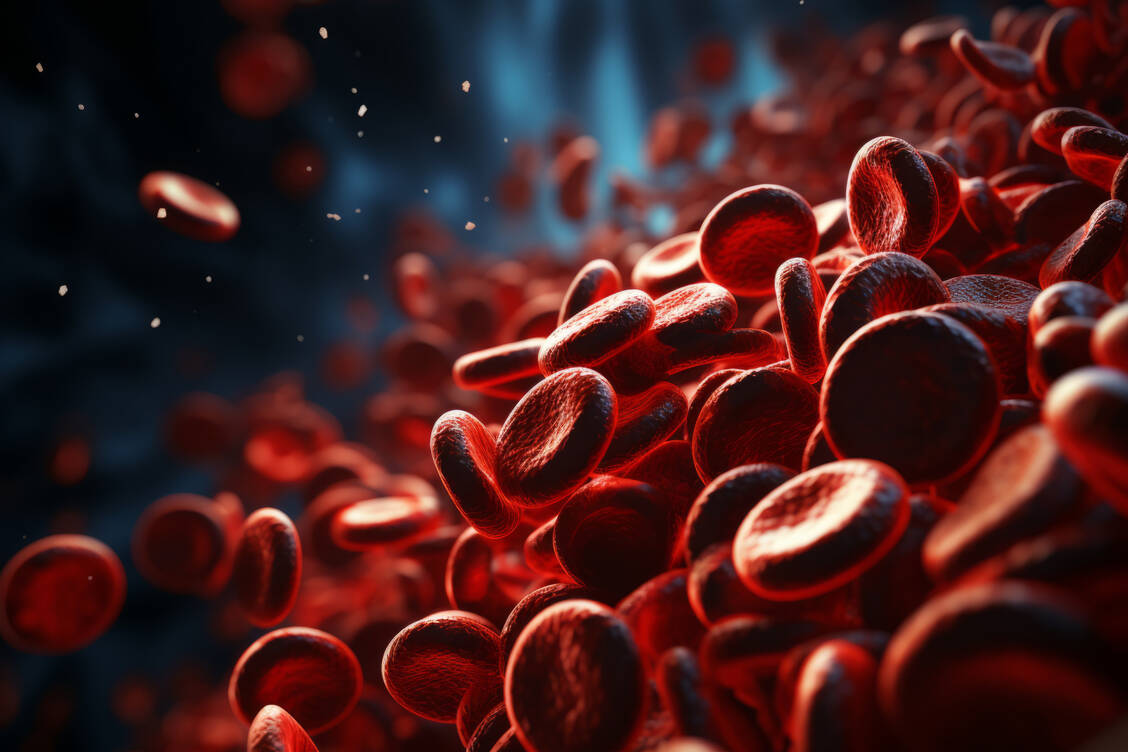Mit Iptacopan und Danicopan kamen dieses Jahr bereits zwei neue Wirkstoffe für die PNH-Therapie auf den Markt. Nun folgte mit Crovalimab der dritte Neuling bei PNH. Anders als die erstgenannten ist Crovalimab jedoch nicht bei den Sprunginnovationen einzuordnen, sondern bei den Schrittinnovationen.
Wie Eculizumab und Ravulizumab, die beide schon lange im Handel sind (und auch bei anderen Erkrankungen zugelassen sind), ist Crovalimab gegen den Komplementfaktor C5 gerichtet. Das Wirkprinzip ist damit nicht innovativ. Auch im Anwendungsgebiet PNH bringt der Neuling derzeit keinen weiteren Vorteil. Während Eculizumab und Ravulizumab schon bei kleinen Kindern zum Einsatz kommen dürfen, ist dies bei Crovalimab erst ab zwölf Jahren der Fall.
Beim Applikationsintervall kann Crovalimab, das in der Erhaltungsphase vierwöchentlich gegeben wird, einen Vorteil gegenüber dem häufiger zu verabreichenden Eculizumab verbuchen. Gegenüber Ravulizumab, dessen Erhaltungsdosen alle acht Wochen gegeben werden, ist dieser Vorteil allerdings nicht gegeben.
Grundlage für die Einstufung als Schrittinnovation sind zunächst einmal die Studien, die eine vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit von Crovalimab im Vergleich zu Eculizumab zeigen. Der große Vorteil von Crovalimab ist jedoch, dass es anders als die beiden anderen Antikörper nicht infundiert werden muss, sondern subkutan appliziert wird. Das können die Patienten selbst zu Hause machen. Zeitaufwendige Praxis- oder Klinikaufenthalte für die Infusionen entfallen und die Applikationszeit ist kürzer. Das dürfte sich positiv auf die Lebensqualität der Betroffenen auswirken.
Sven Siebenand, Chefredakteur