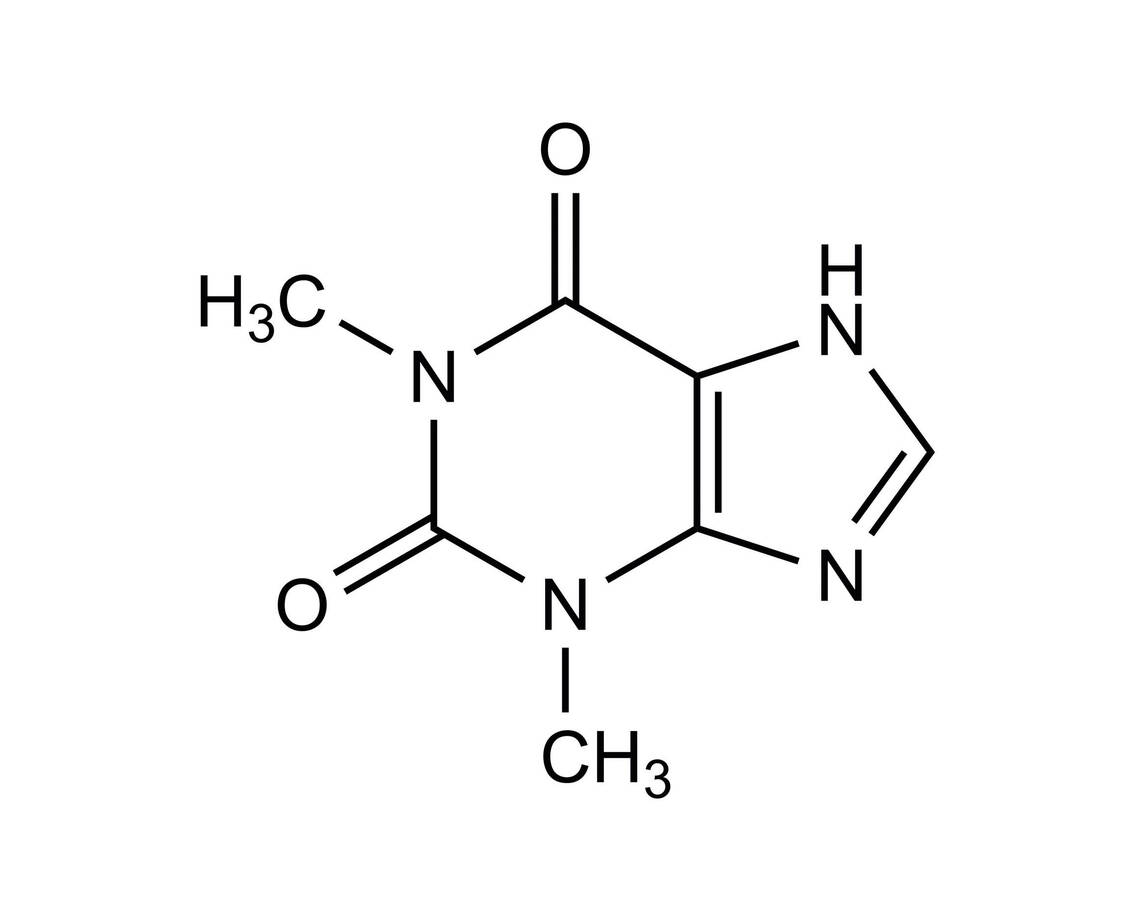Im Handel sind Retardtabletten mit 100/200/350/500 mg Theophyllin sowie eine Injektionslösung mit 200 mg Theophyllin. Der Wirkstoff wird individuell nach Wirkung dosiert, wobei Alter, Gewicht und Begleitmedikation eine Rolle spielen. Erwachsene bekommen in der Regel eine tägliche Erhaltungsdosis von 11 bis 13 mg Theophyllin pro Kilogramm Körpergewicht (KG).
Bei übergewichtigen Patienten wird für die Dosisermittlung als KG das Normalgewicht zugrunde gelegt, da Theophyllin vom Fettgewebe nicht aufgenommen wird. Bei Patienten über 60 Jahren muss der Wirkstoff niedriger dosiert werden, da sie ihn langsamer ausscheiden. Hingegen ist bei Rauchern und Kindern über sechs Monaten die Elimination beschleunigt, sodass die Dosis erhöht werden muss (etwa 18 mg/kg KG). Bei Kindern wird Theophyllin allerdings nur noch in begründeten Ausnahmefällen eingesetzt.
Idealerweise wird die Dosis anhand der Theophyllin-Serumkonzentration ermittelt. Angestrebt wird ein Bereich von 5 bis 12 µg/ml; 20 µg/ml sollten nicht überschritten werden.
Die Behandlung sollte möglichst am Abend kurz vor dem Schlafengehen beginnen und langsam über zwei bis drei Tage gesteigert werden. Die Tabletten sind nach den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen und die Tagesdosis auf eine morgendliche und abendliche Dosis aufzuteilen (zwölf Stunden Abstand).