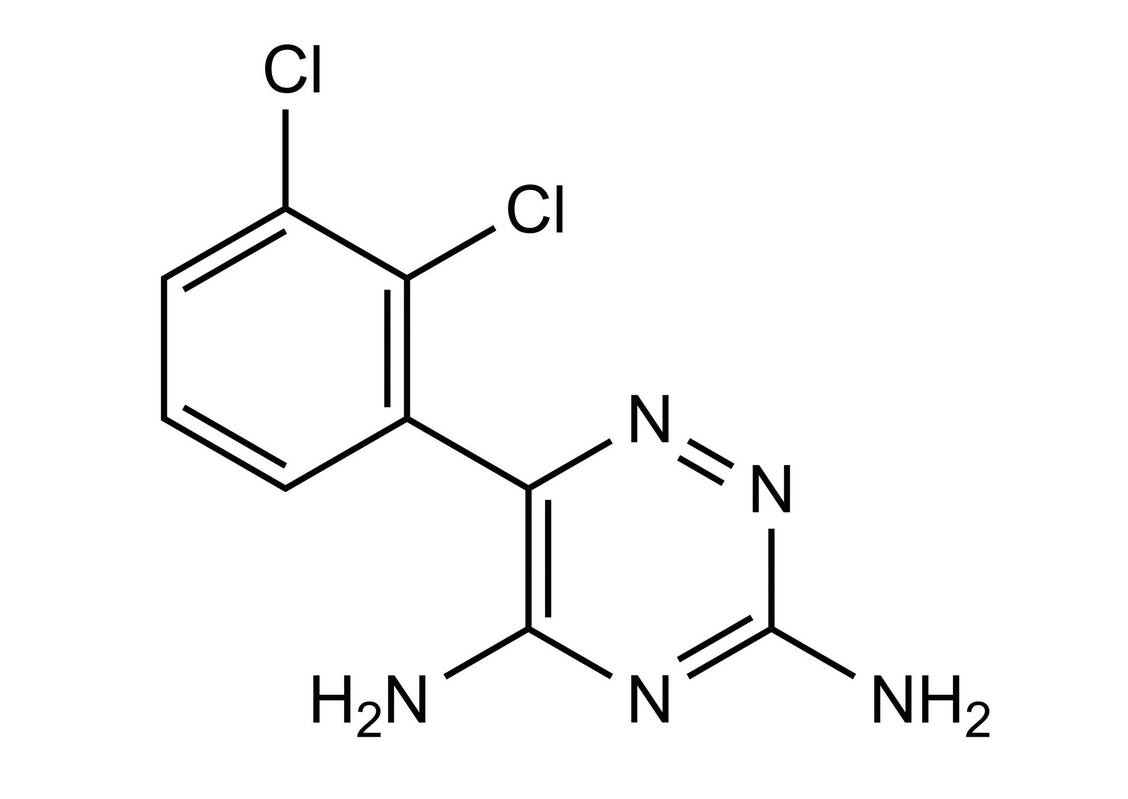Um Überempfindlichkeitsreaktionen zu vermeiden, wird Lamotrigin einschleichend dosiert. Die Therapie startet bei Patienten ab 13 Jahren mit 25 mg einmal täglich in den ersten beiden Wochen, gefolgt von 50 mg einmal täglich in den Wochen 3 und 4. Danach wird die Dosis weiter alle zwei Wochen um maximal 50 bis 100 mg täglich bis zum optimalen Ansprechen erhöht. Die Erhaltungsdosis beträgt üblicherweise 100 bis 200 mg Lamotrigin täglich, die auf einmal oder aufgeteilt auf zwei Einzeldosen eingenommen werden kann. Bei Kindern zwischen 2 und 12 Jahren wird Lamotrigin abhängig vom Gewicht dosiert.
Valproinsäure hemmt die Glucuronidierung von Lamotrigin, während andere Wirkstoffe wie Carbamazepin, Phenytoin, Primidon, Rifampicin und Lopinavir/Ritonavir sie induzieren. Dies muss in der Aufdosierungs- und Erhaltungsphase berücksichtigt werden, wenn Lamotrigin gleichzeitig mit diesen Wirkstoffen angewendet wird (niedrigere Lamotrigin-Dosis bei Kombination mit Valproinsäure, höhere in Kombination mit den anderen genannten Wirkstoffen).
Lamotrigin-Tabletten sollten möglichst immer zur gleichen Tageszeit vor oder nach dem Essen eingenommen werden. Zur Erleichterung der Einnahme bei Kleinkindern dürfen die Tabletten zerkaut oder in Wasser aufgeschlämmt werden.
Wird Lamotrigin abgesetzt, soll das bei Epilepsien stufenweise über einen Zeitraum von zwei Wochen geschehen, um das Risiko von Rebound-Anfällen zu senken. Bei Patienten mit bipolaren Störungen kann diese Vorsichtsmaßnahme nach Absprache mit dem Arzt entfallen.