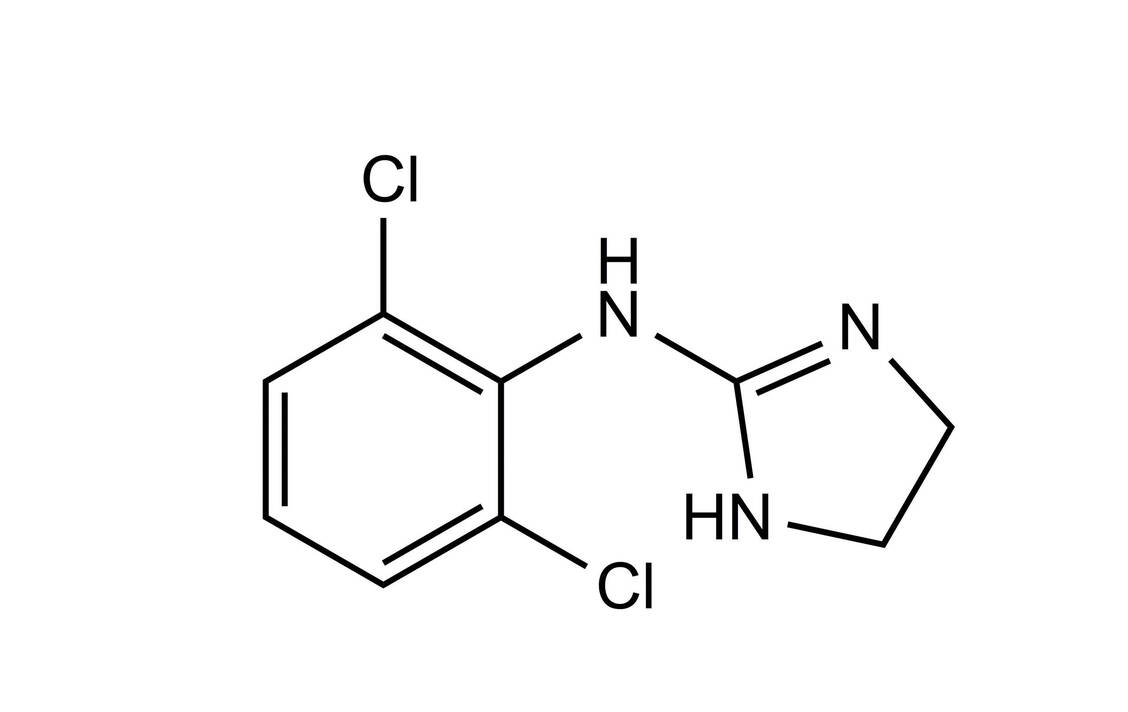Die Tagesdosen richten sich nach dem antihypertensiven Effekt und liegen meist zwischen 0,15 mg und 0,6 mg Clonidinhydrochlorid, aufgeteilt in zwei Einzeldosen. Orale und parenterale Dosen von 0,9 bis 1,2 mg sollten nicht überschritten werden. Bei der Einstellung schwerer Hochdruckformen können in Ausnahmefällen jedoch Tagesdosen von 1,2 bis 1,8 mg erforderlich sein, die parenteral über den Tag verteilt verabreicht werden.
Eine Dosissteigerung sollte langsam erfolgen. Umgekehrt wird auch bei Therapieende langsam stufenweise abdosiert, um akute Absetzsymptome, zum Beispiel überschießenden Blutdruckanstieg und Tachykardie, begleitet von Kopfschmerz, Übelkeit, Nervosität, Zittern und Unruhe zu vermeiden.
Die Augentropfen werden zwei- bis dreimal täglich getropft.