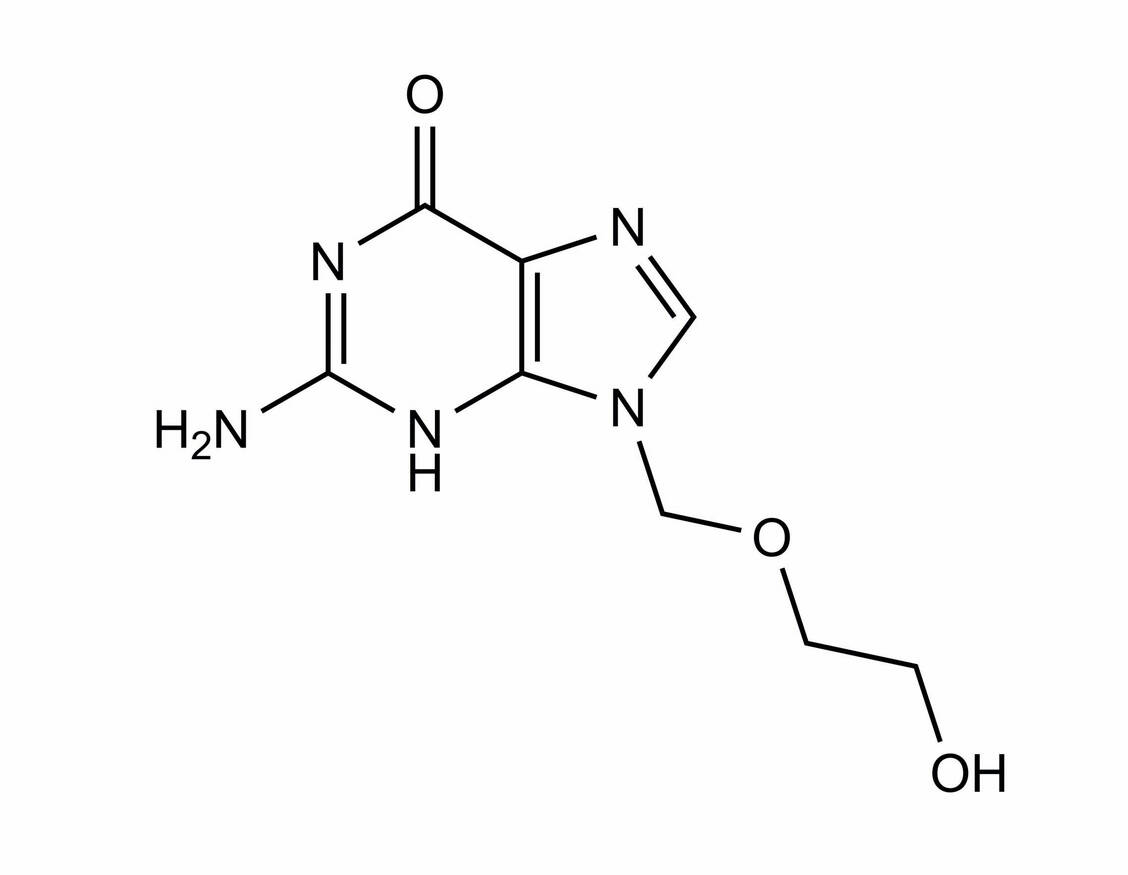Aciclovir ist je nach Indikation in verschiedenen Darreichungsformen verfügbar: als Lippencreme, Creme, Tablette, Infusion, Augensalbe und Suspension. Mit einer Behandlung sollte so früh wie möglich begonnen werden.
Bei Lippenherpes wird Aciclovir-Creme fünfmal täglich alle vier Stunden tagsüber dünn auf die infizierten und die angrenzenden Hautbereiche auftragen. Bei Herpes-simplex-Infektionen des Auges wird ein etwa 1 cm langer Salbenstrang fünfmal täglich alle vier Stunden in den unteren Bindehautsack eingebracht.
Bei systemischer Gabe muss der Wirkstoff wegen seiner schlechten Bioverfügbarkeit (10 bis 30 Prozent) und kurzen Halbwertszeit (knapp drei Stunden) vergleichsweise häufig verabreicht werden, damit die Therapie Erfolg hat. Die folgenden Dosisangaben gelten für Patienten mit normaler Nierenfunktion. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion muss die Dosis entsprechend angepasst werden. Zudem ist bei ihnen besonders auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Erwachsene und Kinder über zwei Jahre nehmen bei einer Herpes-simplex-Infektion fünfmal täglich eine Tablette mit 200 mg Aciclovir ein; empfohlen wird ein Einnahmeabstand von vier Stunden. Kinder unter zwei Jahren bekommen die Hälfte der Erwachsenendosis. Die Behandlungsdauer beträgt fünf Tage.
Bei Herpes zoster gilt für Erwachsene eine Dosis von 800 mg fünfmal täglich im Abstand von vier Stunden. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel sieben Tage.
Als Infusion kommt Aciclovir zum Einsatz, wenn aufgrund einer geschwächten Immunabwehr mit einem schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist. Bei einer Infusionslösung mit beispielsweise 25 mg Aciclovir pro ml Konzentrat beträgt die Dosis für Erwachsene 5 mg/kg Körpergewicht alle acht Stunden. Die Behandlung kann je nach Indikation fünf bis 21 Tage dauern. Die Dosierung zur Behandlung von Neugeborenen, Säuglingen und Kindern unter zwölf Jahren sollte anhand des Körpergewichts berechnet werden (zum Beispiel 10 mg/kg Körpergewicht alle acht Stunden).