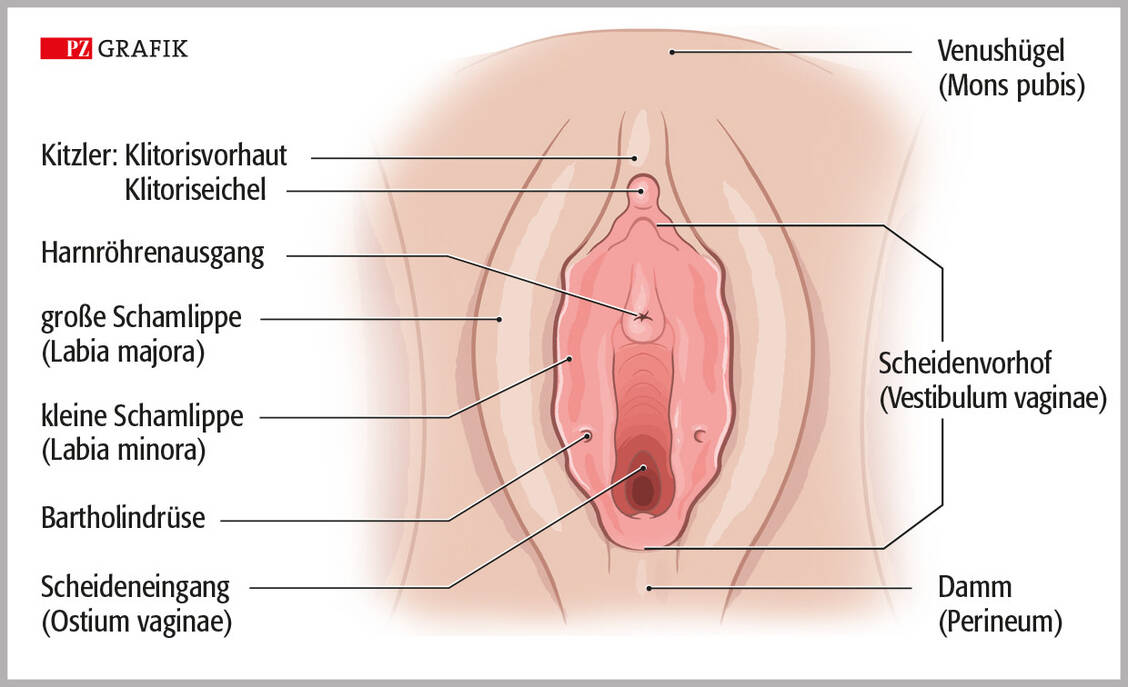Hinter Schmerzen beim Wasserlassen oder beim Geschlechtsverkehr können zahlreiche Ursachen im Bereich der Vagina stecken.
Trichomonaden:
Die einzelligen Parasiten (Trichomonas vaginalis) werden sexuell übertragen, befallen die Schleimhäute der Harnröhre und der Scheide und verursachen Brennen sowie Schmerzen beim Wasserlassen. Den Frauen fällt zudem ein gelblicher Fluor auf. Eine Therapie mit Metronidazol ist meistens bereits nach einmaliger oraler Gabe erfolgreich (vor den Mahlzeiten auf nüchternen Magen: 1,5 bis 2 g Metronidazol, Ausheilungsrate: 90 Prozent) (21). Auch wenn Sexualpartner oder -partnerin keine Symptome spüren, sollten sie immer mitbehandelt werden, um eine Wiederansteckung zu vermeiden.
Da bei einer Infektion mit Trichomonaden die Vaginalflora deutlich mitleidet, ist es ratsam, ein gesundes Mikrobiom wiederherzustellen, damit keine weiteren Infektionen auftreten. Dafür kann das Apothekenteam den Frauen etwa lokal applizierbare Laktobazillen empfehlen.
Pilzinfektionen:
Infektion mit Hefepilzen der Gattung Candida (C.) sind häufig und können bei schweren Entzündungen der Scheide oder der Harnröhre auch zu Schmerzen beim Sex oder beim Wasserlassen führen. Zur Therapie sind topische Antimykotika wie Ciclopirox, Bifonazol oder Clotrimazol als Vaginalzubereitung verfügbar (22). Problematisch ist die hohe Rezidivrate: Etwa 10 Prozent der Frauen erkranken trotz erfolgreicher Therapie immer wieder (22). Bei einer rezidivierenden Candidose mit dem häufigsten Erreger C. albicans können Itraconazol-Präparate (orale Ein-Tages-Therapie) oder eine einmalige Dosis Fluconazol helfen.
Chlamydien:
Eine genitale Chlamydien-Infektion kann sich ebenfalls durch Brennen beim Wasserlassen oder durch Unterleibsschmerzen zeigen. Allerdings verläuft die Mehrheit der Infektionen symptomlos und wird daher nicht behandelt. In der Folge können Komplikationen wie eine Entzündung des Bauchfells (Peritonitis) oder der Leberkapsel (Perihepatitis) auftreten. Gefürchtet ist auch die Eileiterschwangerschaft oder das Verkleben des Eileiters, wodurch die Frauen unfruchtbar werden können. Bei Schwangeren erhöht eine genitale Infektion mit Chlamydien das Risiko für eine Frühgeburt. In der Mutterschaftsvorsorge wird daher auf Chlamydien getestet.
Die Behandlung erfolgt mit Antibiotika wie Tetrazyklinen (Doxycyclin), Makroliden (Erythromycin, Clarithromycin oder Azithromycin) oder Chinolonen (Beispiel Levofloxacin). Für Schwangere wird eine Tablette Azithromycin empfohlen, da Doxycyclin unter anderem die Zahnentwicklung des ungeborenen Kindes stören kann (23).
Scheidentrockenheit:
Ein nicht infektiöser Grund für Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ist die Scheidentrockenheit, die natürlicherweise im Klimakterium aufgrund abnehmender Estrogen-Spiegel auftritt. Dies geht mit einer geringeren Durchblutung und Elastizität des Gewebes der Scheide einher. Die Schleimhaut wird insgesamt dünner und trockener. Das Risiko für Scheidentrockenheit ist zudem bei Frauen erhöht, die an Diabetes mellitus erkrankt sind, einen niedrigen Body-Mass-Index (BMI) haben oder in einer schlechten physischen Verfassung sind (24). Lokal anwendbare feuchtigkeitsspendende Vaginalgele oder -cremes – mit und ohne Hormone – können die Schmerzen sowie den häufig ebenfalls auftretenden Juckreiz oder das Brennen lindern.