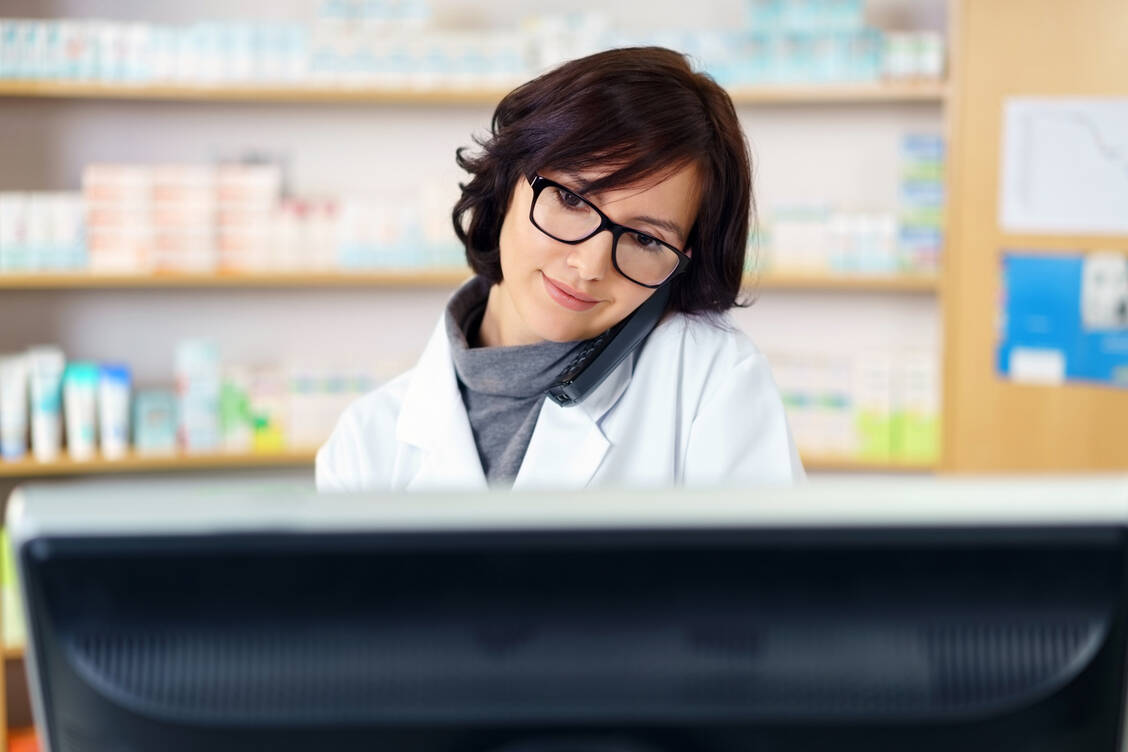Einfacher ist es, wenn vor dem Beratungstermin bereits systematisch Unterlagen, gegebenenfalls auch von einer PTA, vorbereitet werden. Wenn diese einen Patienten anspricht und für die Medikationsanalyse gewinnt, sollte sie sich schon erste Daten geben lassen. Sie kann bereits den Medikationsplan kopieren, aktuelle Beschwerden, die für den Patienten im Vordergrund stehen, aufnehmen, einen Termin vereinbaren und die Unterlagen zur Unterschrift vorbereiten.
Der Apotheker kann dann vorab die Informationen überprüfen, Unklarheiten und potenzielle häufige AMTS-Risiken bei bestimmten Arzneimitteln (Teilbarkeit, falsche Einnahmezeitpunkte, erklärungsbedürftige Anwendung) notieren, um sie im Anamnesegespräch gezielt anzusprechen.