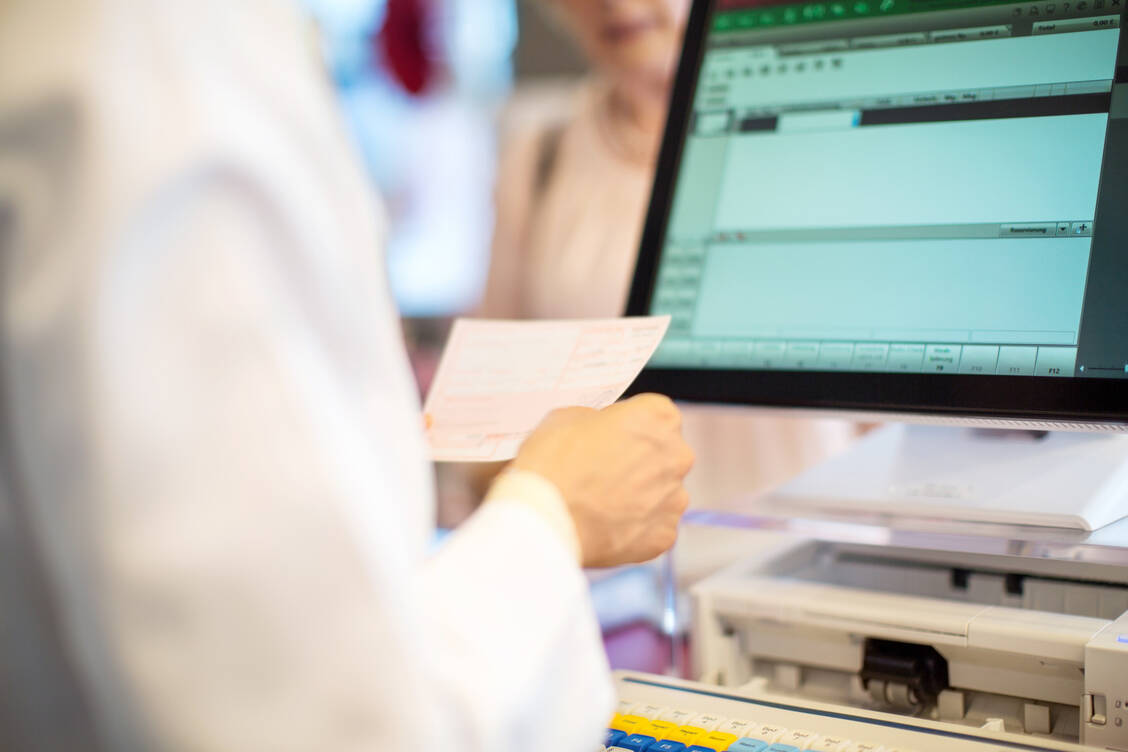Dieses Schema veranschaulichte Herdegen anhand von Beispielen wie der Kombination von Amitriptylin (1 x 150 mg) und Tramadol (2 x 100 mg retardiert). Um das Risiko für ein Serotonin-Syndrom zu evaluieren, heißt es zunächst: Kontraindikationen überprüfen. Gemäß den jeweiligen Fachinformationen liegt hier keine absolute Kontraindikation vor, die Kombination gilt aber als »nicht empfohlen«. Zum Verständnis der AMI erklärte Herdegen: »Serotonin-Syndrom heißt nichts anderes, als dass wir vermehrt Serotonin in der Synapse haben.« Als praktische Grundlage für die Offizin legte er dar: »Alle Substanzen, die an einen Serotonin-Rezeptor gehen, haben ein sehr niedriges Risiko.« Relevant hinsichtlich des Risikos für ein Serotonin-Syndrom seien hingegen Substanzen, die den Serotonin-Reuptake-Transporter oder die Monoaminoxidase A hemmen. Spezielle Risikofaktoren gebe es hier keine, so Herdegen. »Ich würde es abgeben«, schlussfolgerte er. Bei Unsicherheiten könne der Arzt schriftlich mit dem Hinweis »abgegeben unter der Annahme, dass die Interaktion überprüft ist« benachrichtigt werden.