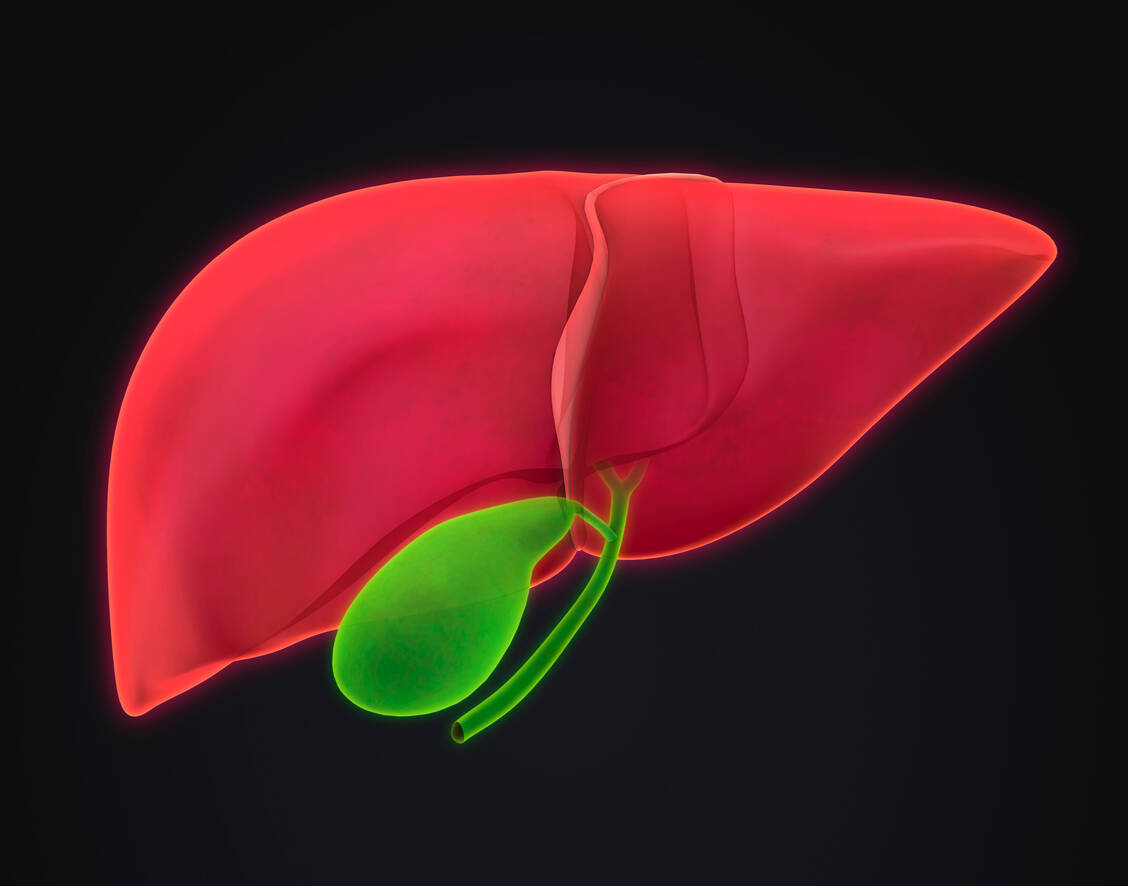Für das Cholangiokarzinom (CCA) stehen nur begrenzte Therapieoptionen zur Verfügung. Die zielgerichtete Therapie mit dem Kinasehemmer Pemigatinib stellt im Falle nachgewiesener FGFR2-Fusionen oder -Umlagerungen einen Fortschritt in der Zweitlinie dar, sodass der neue Wirkstoff als Schrittinnovation angesehen werden kann. Klinisches Ansprechen wurde in vielen Fällen erreicht, wenn auch nur selten definiert als komplettes Ansprechen.
Wie erfolgreich Pemigatinib bei anderen FGF/FGFR-Alterationen ist, kann man aufgrund der geringen Anzahl behandelter Patienten bislang nicht sagen. Grundsätzlich sind weitere Studien erforderlich, um den beobachteten klinischen Nutzen von Pemigatinib beim CCA zu bestätigen. Bislang hat der Kinasehemmer nur eine bedingte Zulassung in der EU erhalten. Mit Interesse darf man zudem auf Ergebnisse einer Head-to-Head-Studie warten, die Pemigatinib versus Chemotherapie in der Erstlinie des CCA vergleicht.
Sven Siebenand, Chefredakteur