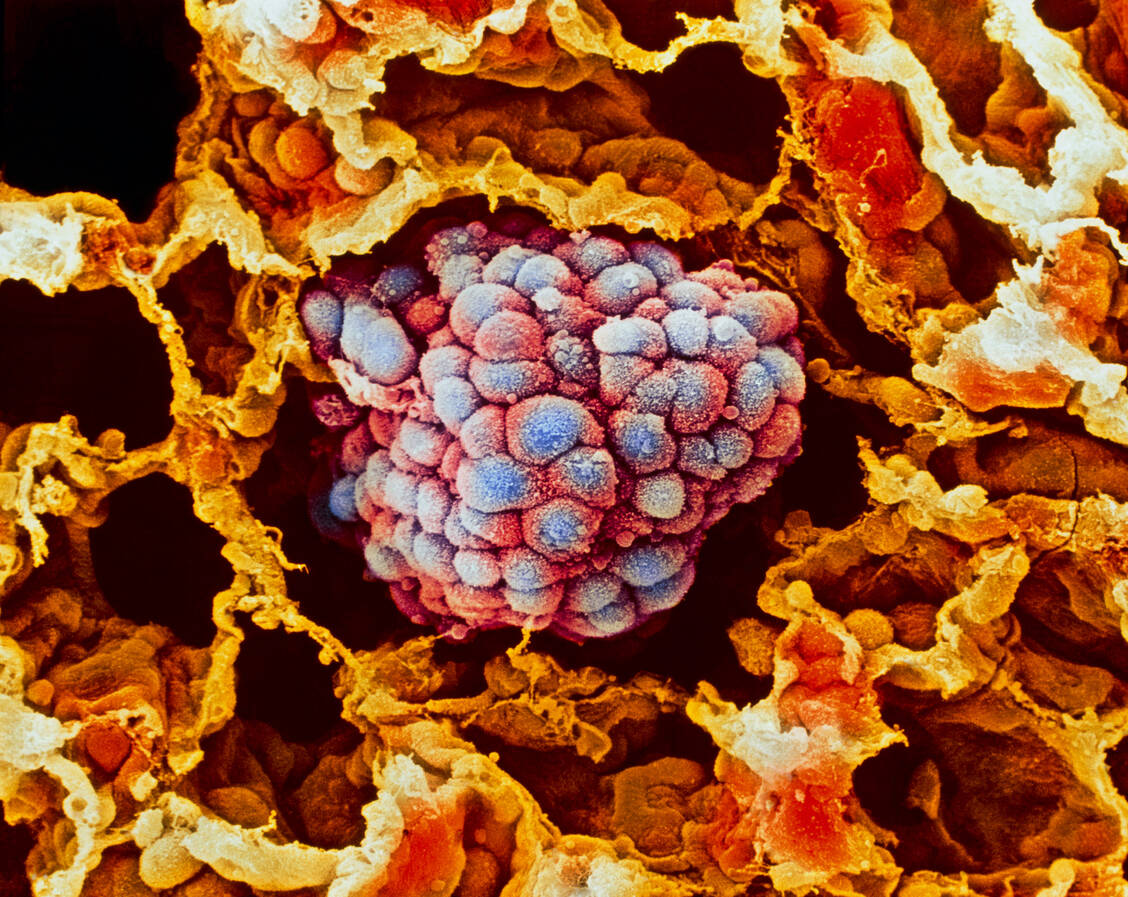Mit Tislelizumab steht eine neue Option für die onkologische Versorgung bei zwei Tumorarten zur Verfügung. Zukünftig könnten noch mehr hinzukommen, denn der Antikörper wird bei einer Reihe weiterer Krebsarten getestet.
Vorläufig ist der Wirkstoff allerdings als Analogpräparat anzusehen. Denn das Wirkprinzip des Checkpoint-Inhibitors Tislelizumab, der eine besonders hohe Affinität und Bindungsaffinität gegen PD-1 aufweist, ist keineswegs neu. Antikörper wie Nivolumab und Pembrolizumab funktionieren ebenso und sind schon seit fast einem Jahrzehnt im Handel. Zudem haben sie mittlerweile nicht nur die Zulassung bei Lungenkrebs und Speiseröhrenkrebs, sondern bei vielen anderen Krebsarten. Sie sind Tislelizumab also mehrere Schritte voraus. Der Neuling war in den Zulassungsstudien zweifelsohne wirksam, aber er wurde nicht gegen die anderen Checkpoint-Inhibitoren getestet.
Sven Siebenand, Chefredakteur