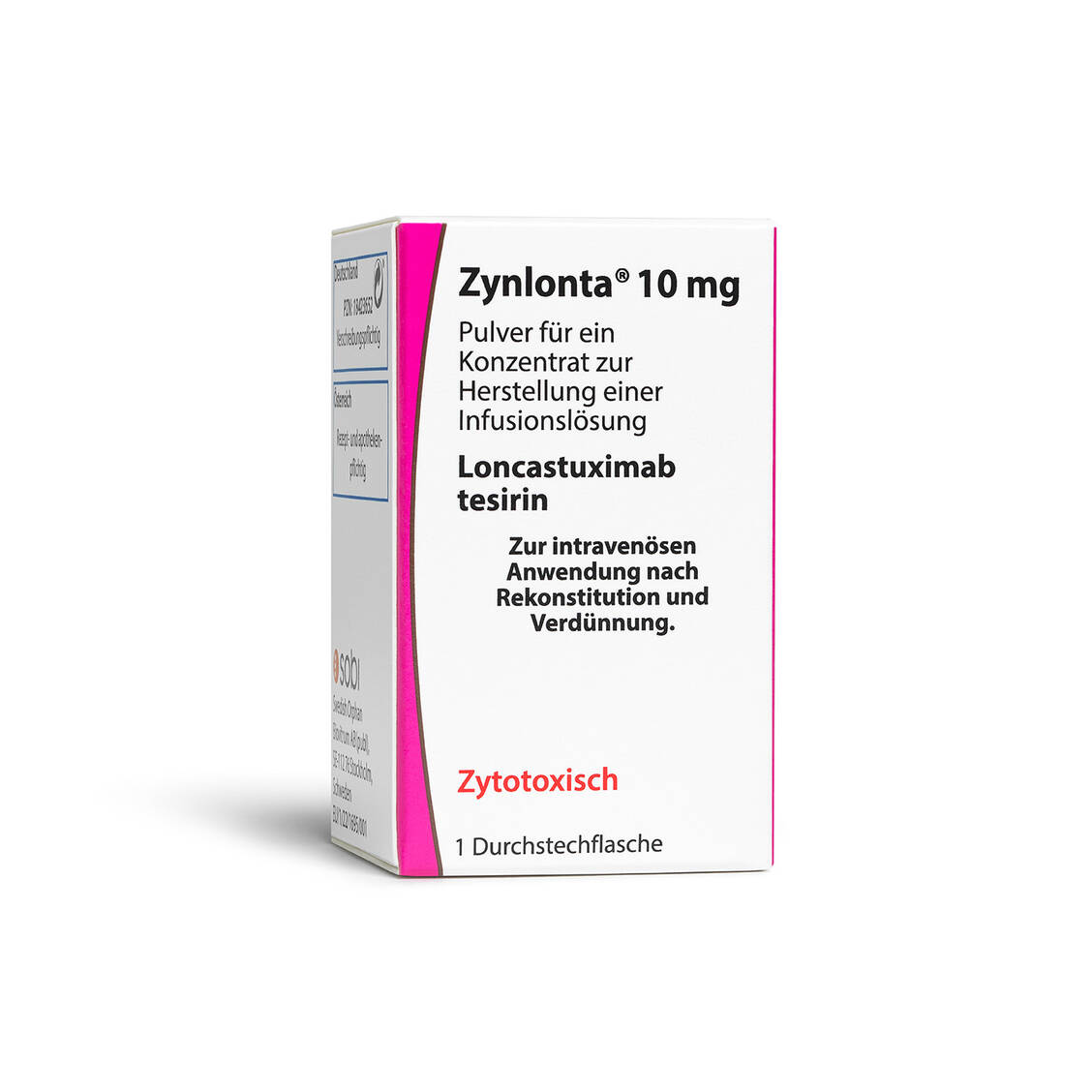Standard in der Erstlinie des DLBCL, in der etwa zwei Drittel der Betroffenen geheilt werden können, ist eine Immunchemotherapie nach dem R-CHOP-Schema. Bei rezidivierten Patienten ist die Prognose deutlich schlechter. Glücklicherweise haben neue Therapieansätze in den vergangenen Jahren aber zu einer Verbesserung geführt, etwa CAR-T-Zelltherapien, Tafasitamab oder Polatuzumab-Vedotin.
Loncastuximab-Tesirin ist nun ein weiterer optionaler Therapiebaustein. Es handelt sich dabei aber weder um das erste Antikörper-Wirkstoff-Konjugat noch um die erste gegen CD19 gerichtete Therapie in dieser Indikation. Einen Stellenwert bei Patienten, bei denen ein kuratives Konzept verfolgt wird, hat Zynlonta nicht. Insgesamt ist sein Innovationspotenzial damit überschaubar.
Dennoch darf man vorläufig die Einstufung als Schrittinnovation vornehmen. Dafür spricht insbesondere die Tatsache, dass Loncastuximab-Tesirin und die verfügbaren CAR-T-Zell-Therapien unterschiedliche CD-19 Epitope adressieren und sich daher nicht ausschließen. Eine Fallserie zeigte, dass nach Therapie mit Loncastuximab-Tesirin rezidivierende Patienten auf eine CAR-T-Zell-Therapie ansprechen können. Anders herum zeigte die Zulassungsstudie, dass das Ansprechen auf Loncastuximab-Tesirin bei Patienten mit beziehungsweise ohne vorherige CAR-T-Zell-Therapie vergleichbar hoch war. Die Summe möglicher Optionen verbessert schlussendlich die Prognose der Patienten. Mit Interesse darf man auf weitere Ergebnisse mit Loncastuximab-Tesirin warten, etwa in Kombination mit Rituximab oder Lenalidomid.
Sven Siebenand, Chefredakteur