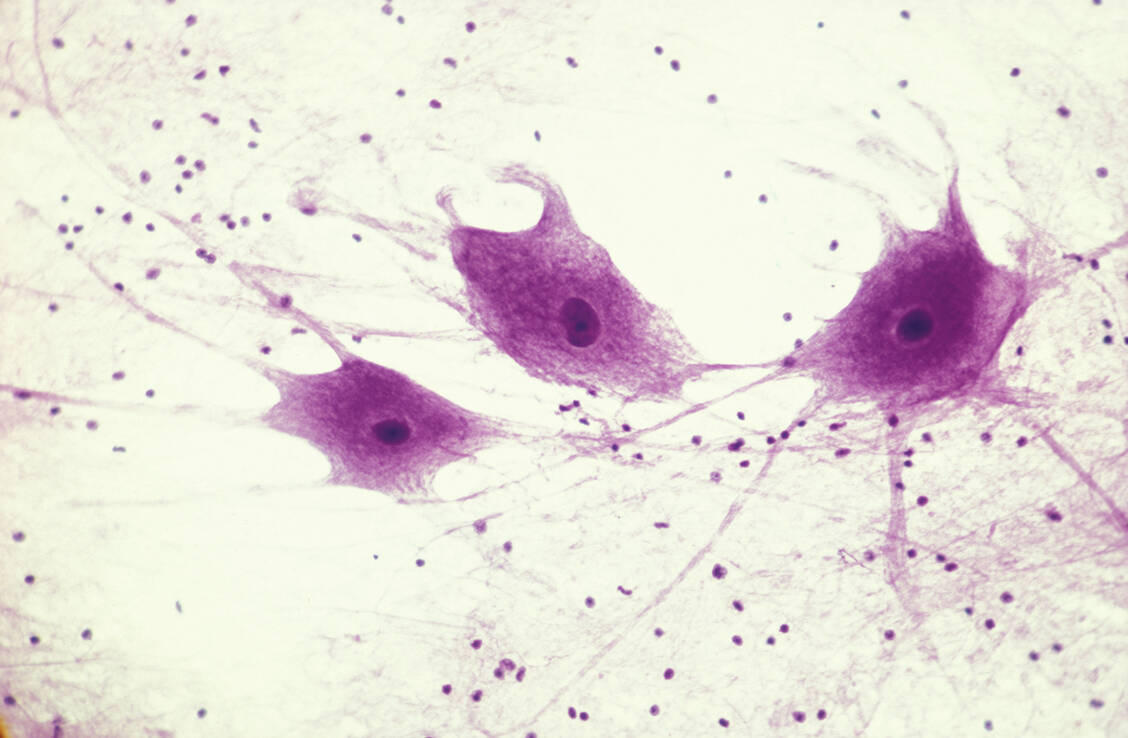Metformin, ein gängiges Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes, wird ebenfalls zunehmend bei Depressionen untersucht. Einige Studien deuten darauf hin, dass Metformin positive Auswirkungen auf die Stimmung haben kann, insbesondere bei Betroffenen mit Insulinresistenz oder metabolischem Syndrom. Laut einer Metaanalyse korreliert die Schwere der Depression mit dem Vorliegen einer Insulinresistenz (25).
Es wird angenommen, dass Metformin Entzündungen und oxidativen Stress reduziert, was zu einer Verbesserung der depressiven und kognitiven Symptome beitragen könnte (26). Dem Arzneistoff werden zudem antiapoptotische und neuroprotektive Wirkungen zugeschrieben.
Sehr interessant sind die Ergebnisse dänischer Registerstudien: Die adjustierten Daten zeigen, dass die längerfristige Einnahme von Metformin unter Real-Life-Bedingungen die Inzidenz depressiver Erkrankungen reduziert (27). Dies belegt auch eine australische Kohortenstudie über 16,6 Jahre mit 704 Frauen: Die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, war unter Metformin deutlich reduziert (28).
Insgesamt ist die Studienlage zwar noch nicht konklusiv, aber es gibt deutliche Hinweise, dass Metformin das Risiko für das Auftreten einer Depression senken kann. Die Ergebnisse lassen hoffen, dass sich aus dem besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen Insulinresistenz und Depression ein neuer Ansatz zur Behandlung von psychischen Erkrankungen ergibt.