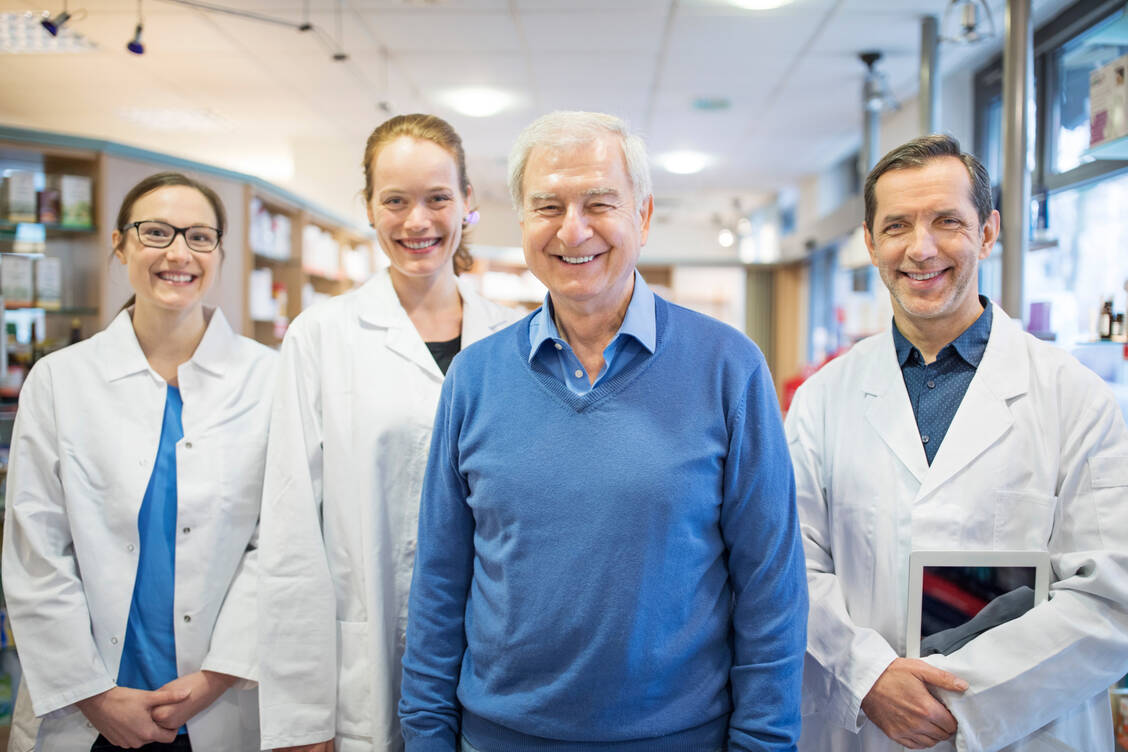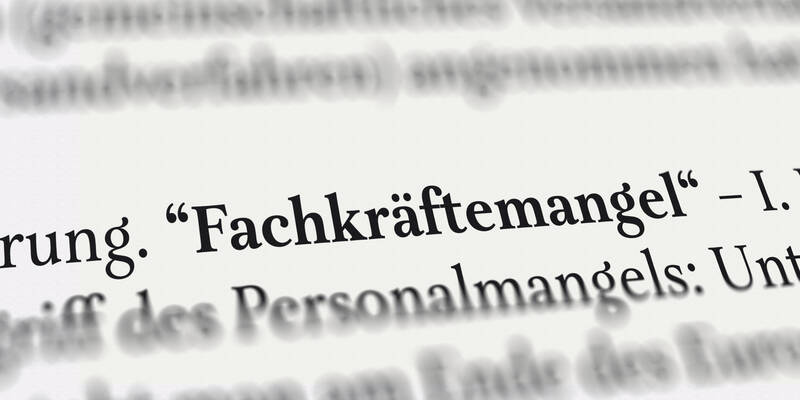Bei aller Not, die insbesondere die Apotheken durch den Personalmangel haben: Er ist kein branchenspezifisches Problem, sondern bekanntlich ein gravierendes gesamtgesellschaftliches. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) blieben im vierten Quartal 2022 bundesweit insgesamt 1,98 Millionen Stellen unbesetzt – »ein neues Allzeithoch«, wie es Anfang März in einer Pressemitteilung hieß. Gegenüber dem Vorquartal stieg die Zahl der offenen Stellen insgesamt um rund 160.900 oder 8,8 Prozent; im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 295.500 oder 17,5 Prozent.
Von den knapp zwei Millionen unbesetzten Stellen lassen sich laut BA rund 301.000 im Gesundheits- und Sozialwesen verorten. Gesundheitsberufe seien seit Beginn der Engpassanalyse, mit der die BA seit 2011 einmal jährlich die Fachkräftesituation am Arbeitsmarkt bewertet, Mangelberufe, erklärt eine BA-Sprecherin im Gespräch mit der PZ. »Und da hat sich bisher keine Entspannung gezeigt.« Den Apothekerberuf listet die BA übrigens seit Dezember 2016 offiziell als Mangel- oder Engpassberuf.
Nach Einschätzung von Alexander Kubis vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der Forschungseinrichtung der BA, dürfte sich dieser Trend allgemein noch verstärken, vor allem wegen des demografischen Wandels sowie der Digitalisierung. Er verweist hierzu auf einen IAB-Beitrag, wonach die Zahl der Menschen, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen, jedes Jahr alterungsbedingt um bis zu 400.000 Personen schrumpft, »wenn es nicht gelingt, dies durch Zuwanderung und steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren auszugleichen«.
Mit einem reformierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz will die Ampelkoalition genau hier ansetzen und die Hürden für qualifizierte Menschen aus dem Ausland senken. Gesundheitsberufe hat die Fachkräftestrategie dabei nicht gezielt im Blick, wie das zuständige Bundesarbeitsministerium der PZ mitteilt.
Jedoch kommen zunehmend ausländische Approbierte in den Markt. Insgesamt 997 Pharmazeutinnen und Pharmazeuten haben laut ABDA 2022 die für den Apothekeneinsatz erforderliche Fachsprachenprüfung abgelegt. Im Jahr 2021 waren es 915. Die Approbierten aus anderen Ländern könnten helfen, den Engpass zu entschärfen.