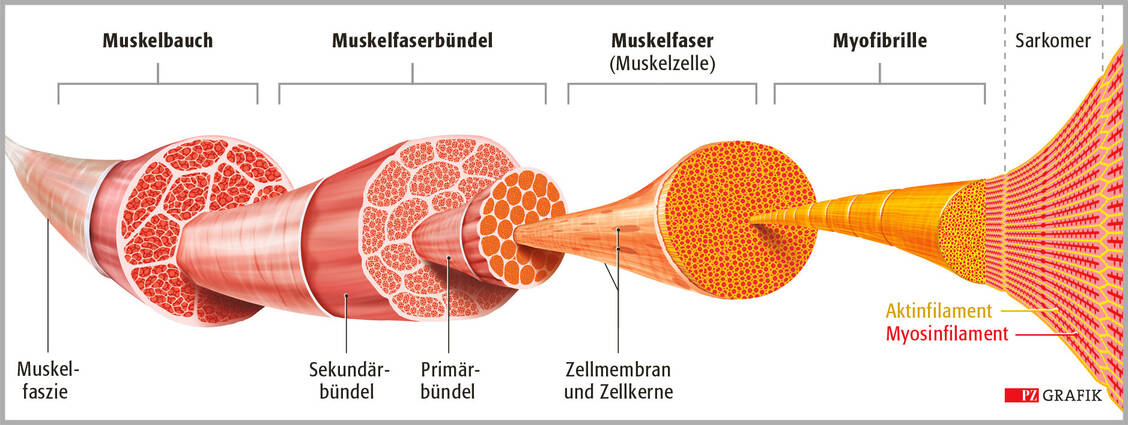Wichtig für die Schaltzentrale in unserem Schädel ist, sich ständig mit neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Das Leben bietet dazu einen multisensorischen Input. Schneider gibt ein Beispiel: »Wenn man einkaufen geht, braucht man Navigationsfähigkeiten, um überhaupt dorthin zu kommen. Um im Supermarkt einkaufen zu können, muss man sich erinnern, was man überhaupt einkaufen wollte: Butter, Milch oder Toastbrot. Dann braucht man sein Langzeitgedächtnis, in welchem Regal überhaupt Butter, Milch und Toastbrot standen. Hier ist das Gehirn gefordert zu arbeiten, sich mit Problematiken auseinanderzusetzen, die exekutiven Funktionen zu benutzen. Das ist für den Erhalt von Biomasse, in dem Fall von Nervenzellen ganz wichtig.«