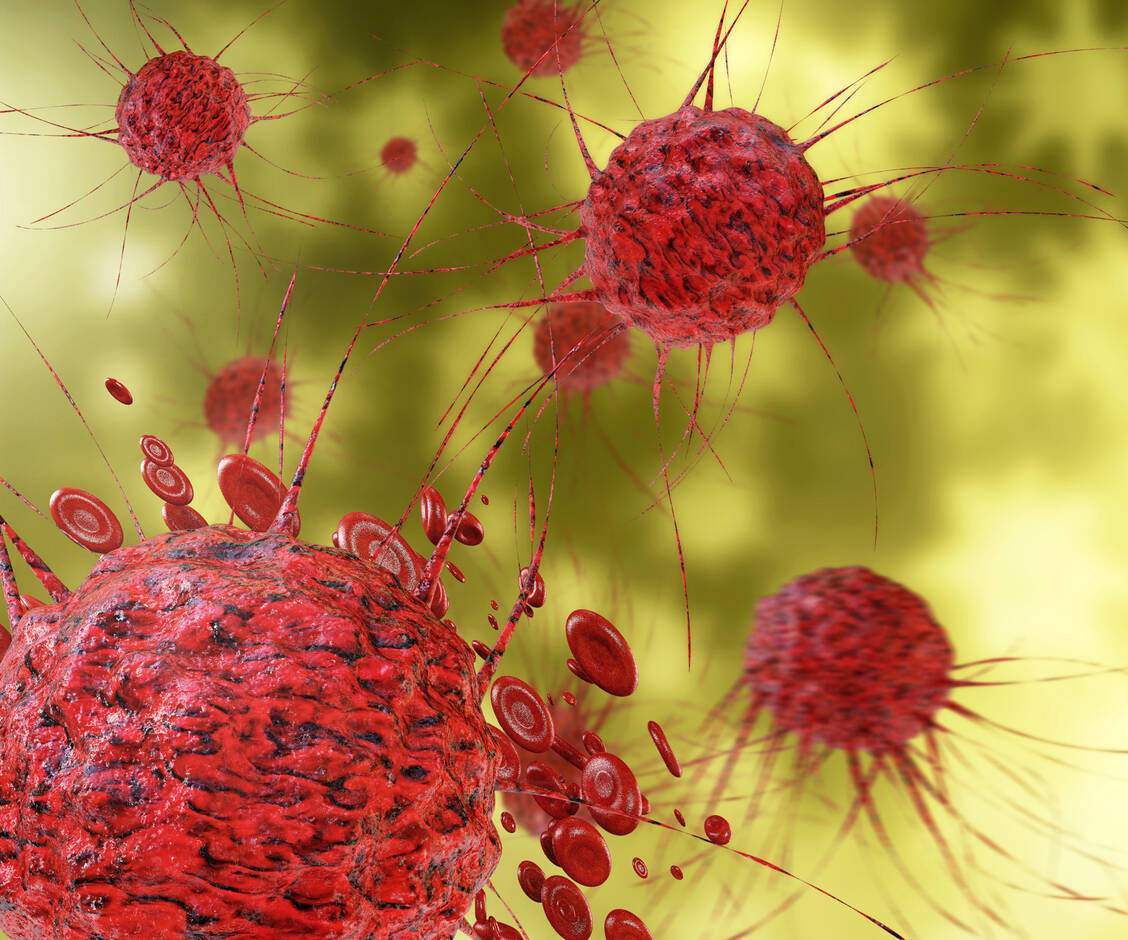Am weitesten in der Entwicklung ist mRNA-4157 von Moderna, ein personalisierter mRNA-Impfstoff, der für bis zu 34 patientenindividuelle Antigene kodiert. Er wird zurzeit in Phase III bei Patienten mit Hochrisiko-Melanom untersucht. Erst vor Kurzem gab der Hersteller Drei-Jahres-Daten aus der Studie bekannt. Der Impfstoff mRNA-4157 (V940) reduziert in Kombination mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab das Risiko für ein Rezidiv oder Tod um 49 Prozent im Vergleich zu Pembrolizumab allein sowie das Risiko für Metastasen oder Tod um 62 Prozent, verkündeten Moderna und sein Partner MSD am 14. Dezember. Die finalen Ergebnisse werden für 2029 erwartet.
Moderna und MSD haben auch eine Phase-III-Studie mit dieser Kombination bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs gestartet und planen, weitere Indikationen zu untersuchen.
Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt Biontech mit seinem Kandidaten BNT122 (Autogene Cevumeran), der ebenfalls in Kombination mit einem Immun-Checkpoint-Inhibitor (Atezolizumab) bei verschiedenen Indikationen getestet wird. Zu fortgeschrittenem Melanom, Darmkrebs und Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse laufen bereits Phase-II-Studien. BNT122 enthält unmodifizierte, pharmakologisch optimierte mRNA, die für bis zu 20 patientenspezifische Neoantigene kodiert, die durch Echtzeit-Sequenzierung der Tumor-DNA und bioinformatische Neoantigen-Erkennung identifiziert wurden. Das Ziel ist laut Biontech, innerhalb von nur vier Wochen ab Erhalt der Blut- und Tumorprobe des Patienten einen individualisierten Impfstoff bereitstellen zu können.