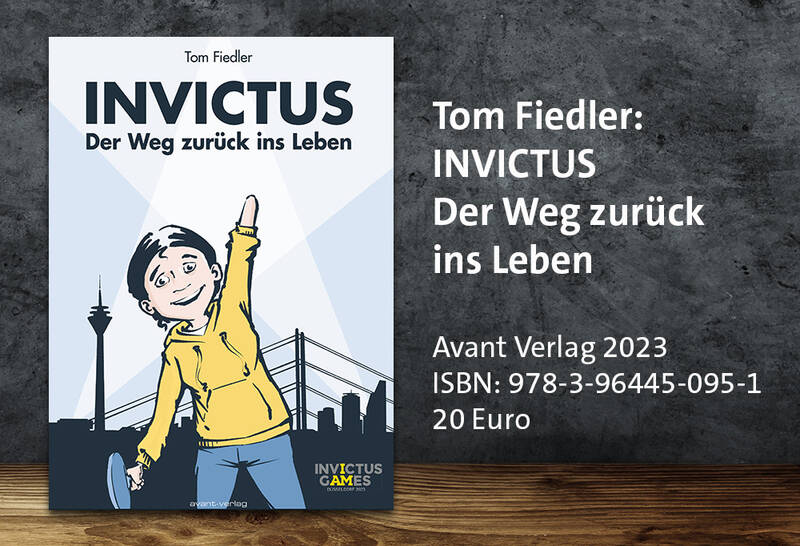Die Bewerbung Deutschlands und das Bekenntnis von Düsseldorf zu den »Invictus Games« empfand ich in 2019 als mutige Schritte. Seitdem wird viel über die Spiele berichtet, es gibt Begegnungen, Diskussionsrunden in Schulen. Man hat die Chance, grundlegenden menschlichen Fragen zu begegnen: Was passiert, wenn das Leben durch Unfall oder Krankheit aus den Fugen gerät? Was bedeutet faire Teilhabe? Welche Haltung habe ich dazu und wie gehe ich mit eigenen Ängsten um?
Es ist ein Reifeprozess für die Bundeswehr und bedeutet mehr Sichtbarkeit für die Gesellschaft. Und natürlich hat auch der Krieg in der Ukraine den Blick auf Menschen in Uniform geändert – ich glaube, dass die Akzeptanz für den Beruf gestiegen ist. Wahrscheinlich gibt es trotzdem auch Menschen, die die Spiele nicht gut finden. Auch das muss man in einer Demokratie aushalten – aber ich wünsche mir für alle Teilnehmenden und deren Familien, dass wir lebendige Spiele erleben und fantastische Gastgeber sind.