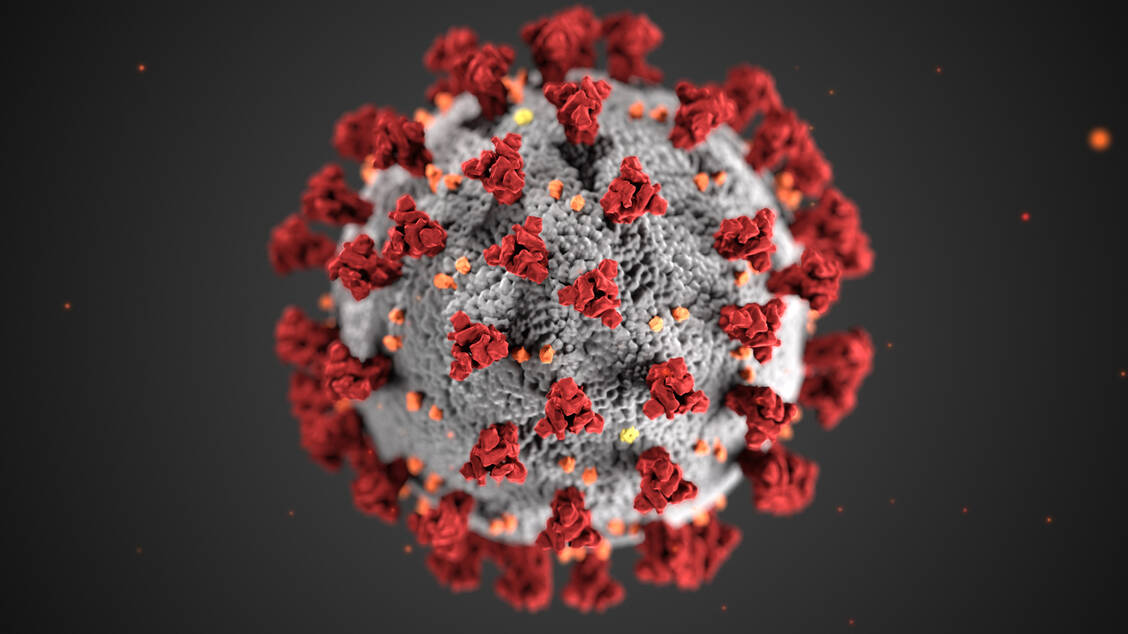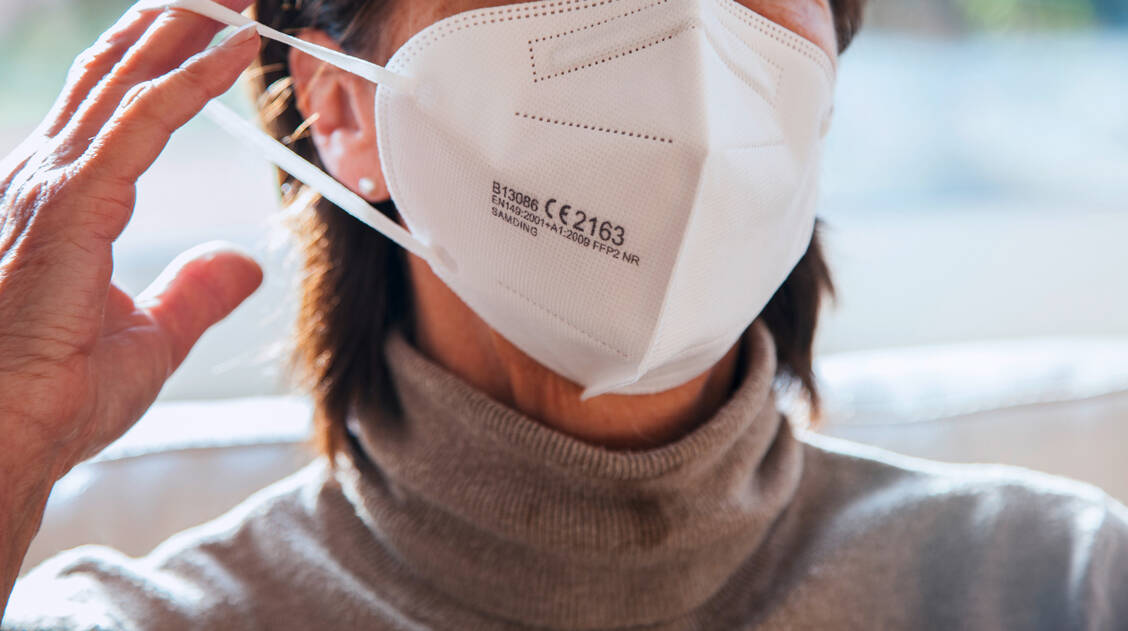27. Januar 2020: Erster bestätigter Fall in Deutschland. Ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Stockdorf bei München ist an Covid-19 erkrankt.
30. Januar 2020: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt eine »gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite«.
4. März 2020: Apotheken in Deutschland wird es per Ausnahmeregelung erlaubt, Händedesinfektionsmittel in großen Mengen herzustellen und in Verkehr zu bringen.
9. März 2020: Erste Todesfälle in Deutschland. Ein 78-Jähriger und eine 89-Jährige in Nordrhein-Westfalen sind an Covid-19 gestorben. Bis Juni 2023 sterben im Verlauf der Pandemie laut Robert-Koch-Institut (RKI) rund 174.400 Menschen in Verbindung mit Covid-19.
22. März 2020: Bund und Länder beschließen weitreichende Beschränkungen sozialer Kontakte. Bis zum Ende der Pandemie gibt es abhängig vom Infektionsgeschehen immer wieder Lockerungen und Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen.
1. April 2020: Das RKI empfiehlt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, beispielsweise eine Stoffmaske, im öffentlichen Raum. Weitaus besseren Schutz bieten FFP2-Masken, die jedoch zunächst nicht in ausreichendem Maß verfügbar sind.
8. April 2020: Mit der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung werden unter anderem Austauschregeln für die Apotheken gelockert und eine Botendienst-Vergütung eingeführt.
16. Juni 2020: Die Bundesregierung startet die Corona-Warn-App.
9. Dezember 2020: Angehörige von Risikogruppen haben laut Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung Anspruch auf eine bestimmte Anzahl kostenloser FFP2-Masken. Die Verteilung erfolgt über die Apotheken.
21. Dezember 2020: Die EU-Kommission erteilt dem mRNA-Impfstoff Tozinameran (Comirnaty®) von Biontech/Pfizer die Zulassung. Die Impfkampagne beginnt Ende Dezember. Bis Februar 2024 sind in Deutschland 76,5 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft und 62,8 Prozent geboostert.
März 2021: Alle Bürger können kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden.
31. Mai 2021: EU-Zulassung für Comirnaty für Kinder ab zwölf Jahren. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Covid-19-Impfung für 12- bis 17-Jährige ab August 2021.
10. Juni 2021: Roll-out des digitalen Impfnachweises in der Corona-Warn-App oder in der CovPass-App. Auch Apotheken können Impfbescheinigungen ausstellen.
8. Februar 2022: Apotheken bieten Impfungen gegen Covid-19 an.
3. Februar 2023: Das RKI stuft die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland von »hoch« auf »moderat« herab.
1. März 2023: In Deutschland entfallen alle Test- und Maskenpflichten.
5. Mai 2023: Die WHO erklärt die »gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite« aufgrund von Covid-19 für beendet.