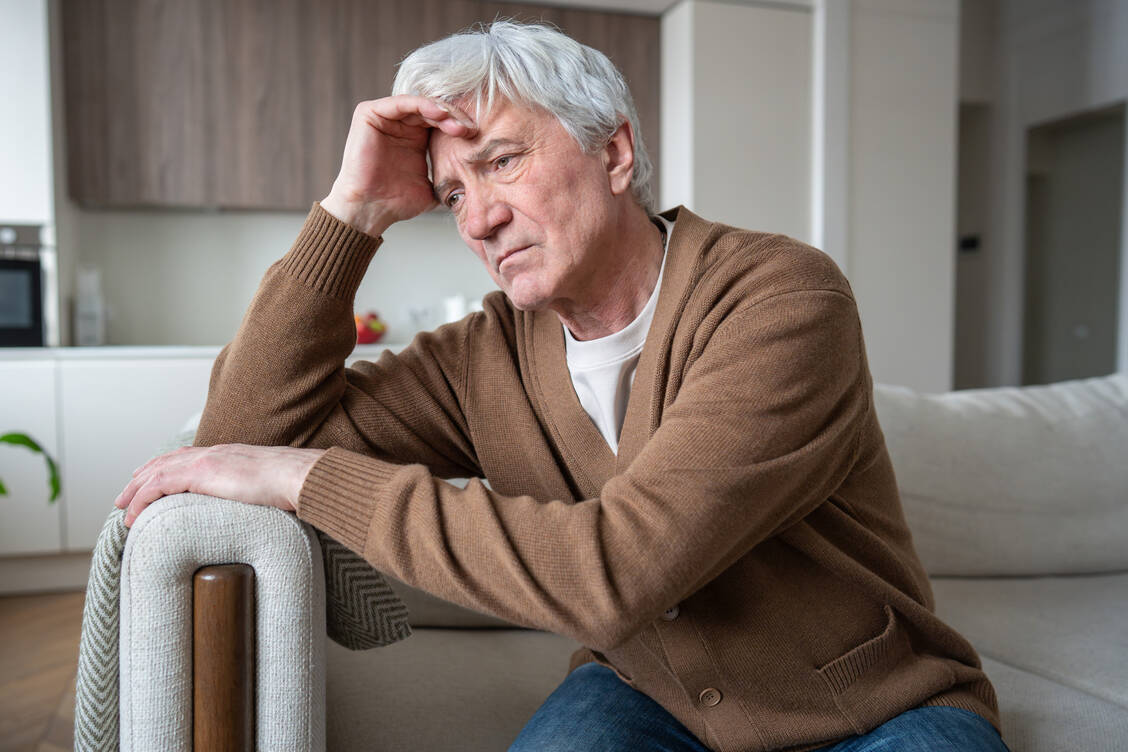Lecanemab darf vorläufig bei den Sprunginnovationen eingruppiert werden. Es ist kein Wundermittel und kann die Alzheimer-Erkrankung nicht heilen. Aber der Antikörper ist die erste verlaufsmodifizierende Therapie, die es auf den deutschen Markt geschafft hat. Die bereits verfügbaren Acteylcholinesterase-Hemmer und Memantin wirken rein symptomatisch.
Wegen der sehr eng gefassten Indikation kommt nur ein geringer Teil von Patienten für die Therapie mit Lecanemab infrage – in Deutschland ist es vielleicht eine kleine fünfstellige Zahl. Das sind nicht viele, aber wenn diese Patienten rechtzeitig gefunden werden, dürfen sie tatsächlich einen Erfolg erwarten.
Patienten, die mit Lecanemab behandelt werden, verweilen länger in frühen Krankheitsstadien – mit zunehmender Stärke des Behandlungseffekts im Zeitverlauf. Innerhalb von 18 Monaten ist ein »Gewinn« von etwa sechs Monaten zu erwarten, der sich bei einer vierjährigen Therapie auf zwölf Monate verlängern kann. Auch auf die Lebensqualität der Betroffenen wirkt sich die Therapie positiv aus, was betreuende Personen entlastet.
Wichtig ist, dass der neue Antikörper möglichst nur von Ärzten eingesetzt wird, die viel Erfahrung mit der Alzheimer-Behandlung haben. Denn vor und unter der Therapie gibt es eine Menge zu prüfen – vom ApoE ε4-Status über regelmäßige MRT-Untersuchungen und deren Auswertung (Stichwort: ARIA) bis hin zur Kontraindikation Antikoagulation. Gerade erst gab es einen Rote-Hand-Brief zu dem Wirkstoff, der am Anfang der Therapie noch eine weitere MRT-Untersuchung vorschreibt. Das ist auch sinnvoll, denn ARIA sind vor allem ein Phänomen der ersten Monate.
Es gilt zukünftig sicher auch, weiter zu lernen, etwa ob Frauen möglicherweise weniger von Lecanemab profitieren als Männer. Eine Post-hoc-Auswertung, die zu diesem Ergebnis kam, ist ein Hinweis, aber kein Beweis. Wichtig sind daher nun Registerstudien, nicht nur zu möglichen Gender-Effekten.
Spannend wird sein, wie der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den Zusatznutzen von Lecanemab einstuft. Den Beschluss erwartet der Hersteller im ersten Quartal 2026. Aus pharmazeutischer Sicht kann man sagen, dass Lecanemab sicher keinen Wow-Effekt hervorruft, aber ein Anfang geschafft ist. Mit Donanemab wird aller Voraussicht nach demnächst ein weiterer ähnlicher Antikörper auf den deutschen Markt kommen. Es ist zu hoffen, dass künftige Generationen von Wirkstoffen mit noch besseren Effekten folgen werden. Gegebenenfalls nehmen auch Therapien, die vor allem auf das Tau-Protein abzielen, an Fahrt auf.
Sven Siebenand, Chefredakteur