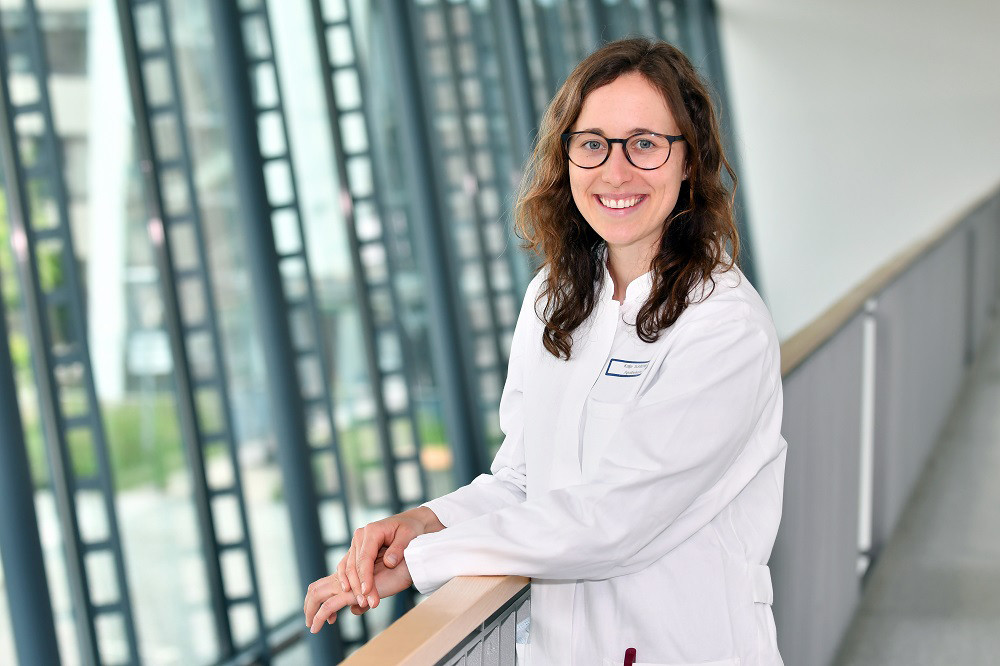Schlichtig: Am wichtigsten ist: Die Einnahme genau erklären. Was bedeutet eigentlich dreimal am Tag – drei Tabletten auf einmal oder dreimal am Tag eine? Und in welchem Abstand, mit oder ohne Nahrung? Man sollte auch Gewohnheiten im Alltag berücksichtigen (wann der Patient aufsteht, isst und wieder ins Bett geht), sodass die Einnahme möglichst gut in den Alltag integriert werden kann. Die Apotheke sollte das leicht verständlich und eindeutig im Medikationsplan vermerken. Oft wissen die Patienten zudem nicht, was sie bei einer vergessenen Einnahme machen sollen. Auch das sollte man besprechen.
Es gibt für fast alle oralen Antitumormedikamente Merkblätter und spezifische Materialien mit Einnahmehinweisen, zum Beispiel in der Oralia-Datenbank der Deutschen Gesellschaft für onkologische Pharmazie (DGOP) oder vom AMBORA-Projekt. Die kann man ausdrucken, als Gesprächsleitfaden nutzen und dem Patienten anschließend mitgeben. Zusätzlich gibt es Informationsmaterialien zum generellen Umgang mit den Medikamenten, zum Beispiel hinsichtlich der Lagerung oder was zu tun ist, wenn der Patient sich erbricht.