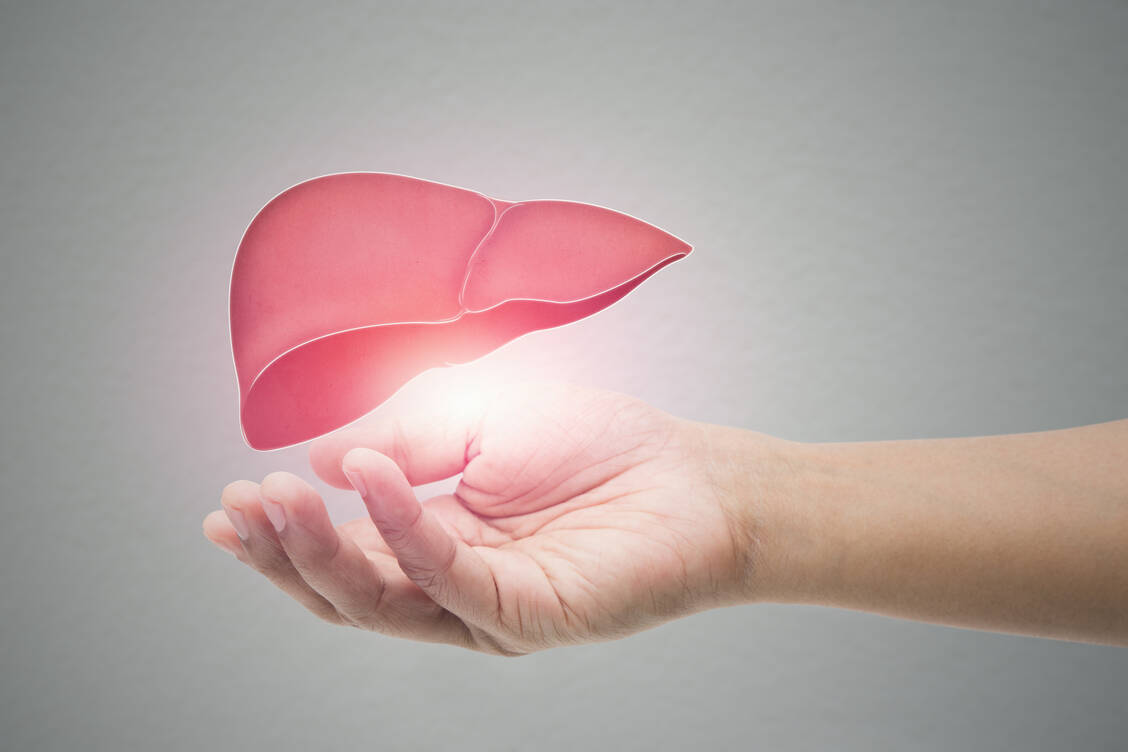Dicke wie dünne Leberpatienten haben häufig dieselben negativen Lebensstilfaktoren wie etwa sitzende Lebensweise und hyperkalorische Kost. Darum setzt an diesem Punkt auch die empfohlene Behandlung an: »Was den Betroffenen aktuell bleibt, sind eine Ernährungsumstellung und ausreichend Bewegung«, betont Geier. »Auch die Rolle der sogenannten Darm-Leber-Achse, also die Wechselwirkungen zwischen der Darmflora und der Leber, könnte wichtige neue Therapieansätze eröffnen. Hier besteht ebenso noch erheblicher Forschungsbedarf.« Erste Studien ließen annehmen, dass Synbiotika (als die Kombination von Probiotikum und Präbiotikum) gleichermaßen Steatose sowie Fibrose bessern, heißt es in der gültigen AWMF-Leitlinie für LEAN NAFLD. Die Entwicklung zielgerichteter Therapien für diese spezielle Subgruppe sei aber noch eine dringende Aufgabe der Forschung, sagt Geier.