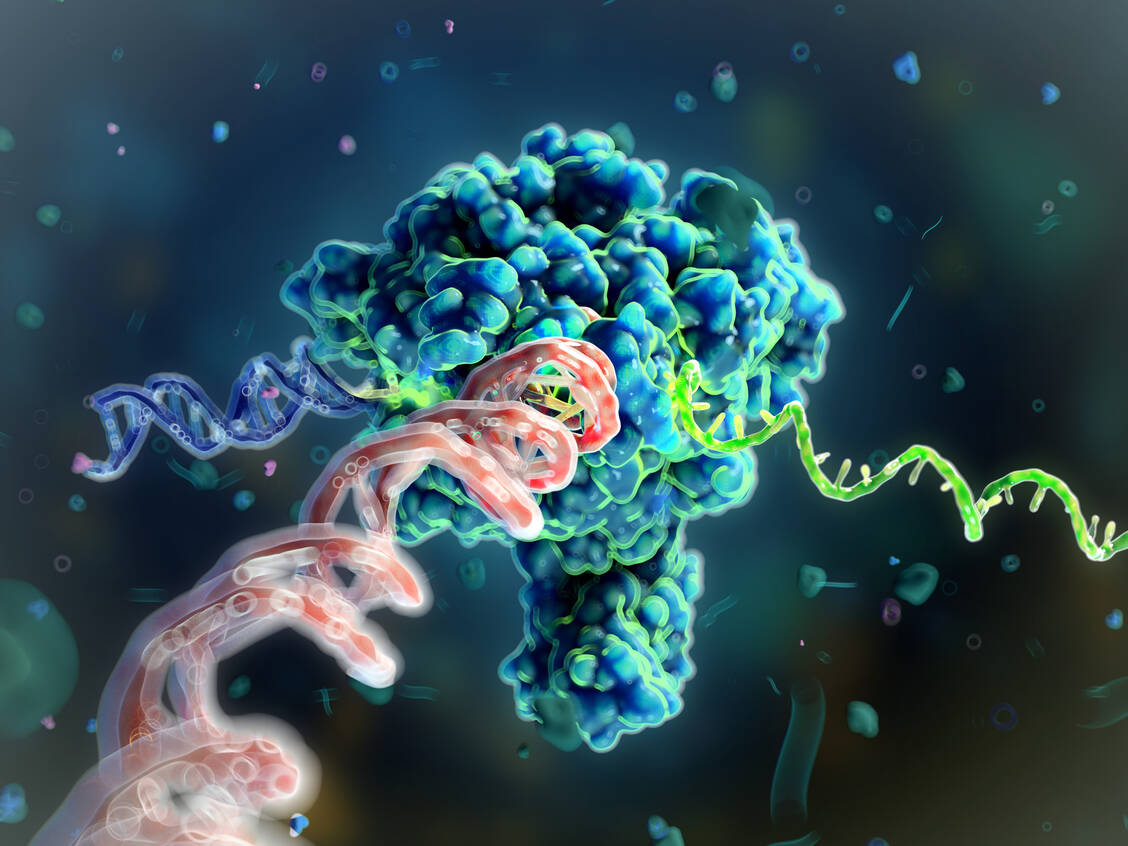Die Gruppe verwendete ein Neuronenmodell, das mithilfe von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) erstellt wurde, denen TDP-43 fehlte. Es konnte zeigen, dass nicht korrekt gespleißte mRNA umfangreich mit Ribosomen, den für das Ablesen der mRNA zuständigen Zellorganellen, interagiert. Das lässt darauf schließen, dass diese mRNA auch aktiv translatiert wird. Schließlich gelang es den Forschenden, 65 Peptide zu identifizieren, die zwölf inkorrekt gespleißten mRNA-Molekülen zugeordnet werden konnten. Diese artifiziellen Proteine ließen sich anschließend auch in postmortalen Großhirnrinden-Proben von ALS/FTD-Patienten identifizieren, was ein starker Hinweis darauf ist, dass das von der Gruppe entwickelte zelluläre In-vitro-Modell eine physiologische Relevanz besitzt.