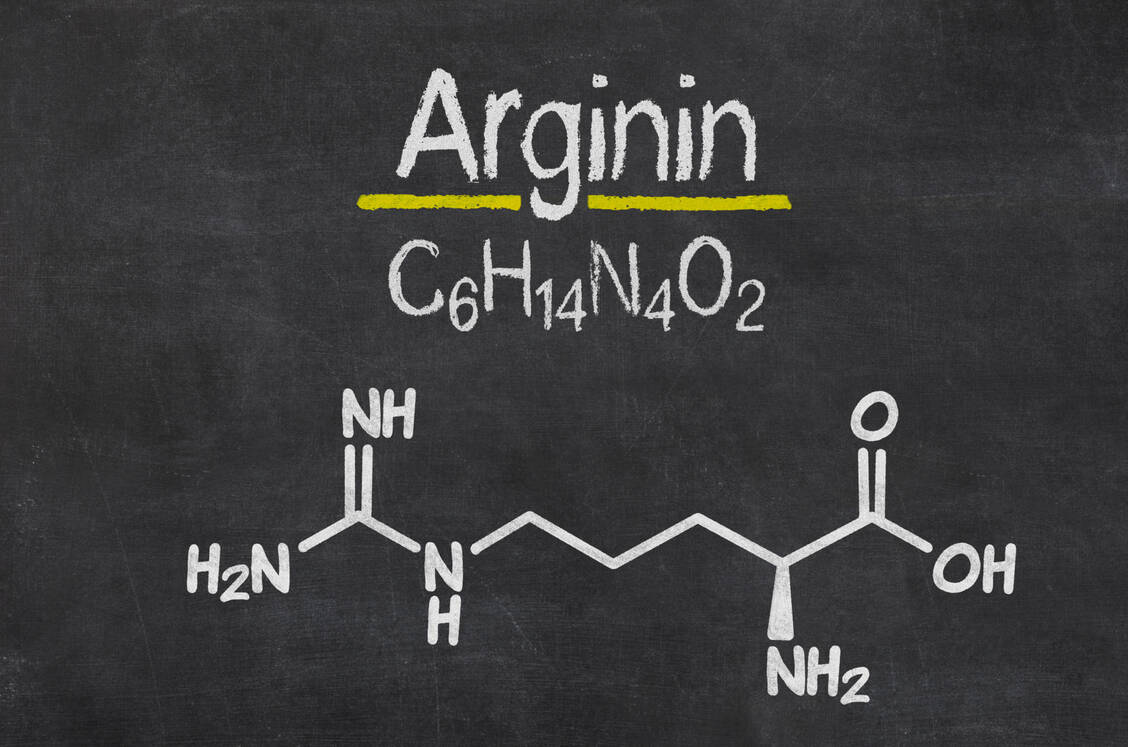Pegzilarginase ist die erste Enzymersatztherapie bei Arginase-1-Mangel und die erste verfügbare krankheitsmodifizierende Behandlung für die Betroffenen. Die vorläufige Bewertung als Sprunginnovation ist damit vertretbar. Aber es gilt, weitere Langzeitergebnisse abzuwarten. Diese werden kommen, da die EMA das Medikament zunächst nur »unter außergewöhnlichen Zuständen« zugelassen hat. Die zulassungsrelevante Studie hat zwar eine deutliche Senkung des Plasma-Arginins zeigen können, die Auswertung der sekundären Mobilitätsendpunkte war aber etwas enttäuschend. Hier zeigte sich nur ein Trend der Verbesserung, kein signifikanter Unterschied zu Placebo. Spannend wird es daher sein, auf Langzeitergebnisse zu schauen. Vorläufige Langzeitdaten stimmen zuversichtlich, dass sich der Nutzen einer Therapie mit Pegzilarginase auch hinsichtlich der motorischen Fähigkeiten der Patienten noch unter Beweis stellen lassen wird.
Sven Siebenand, Chefredaktion