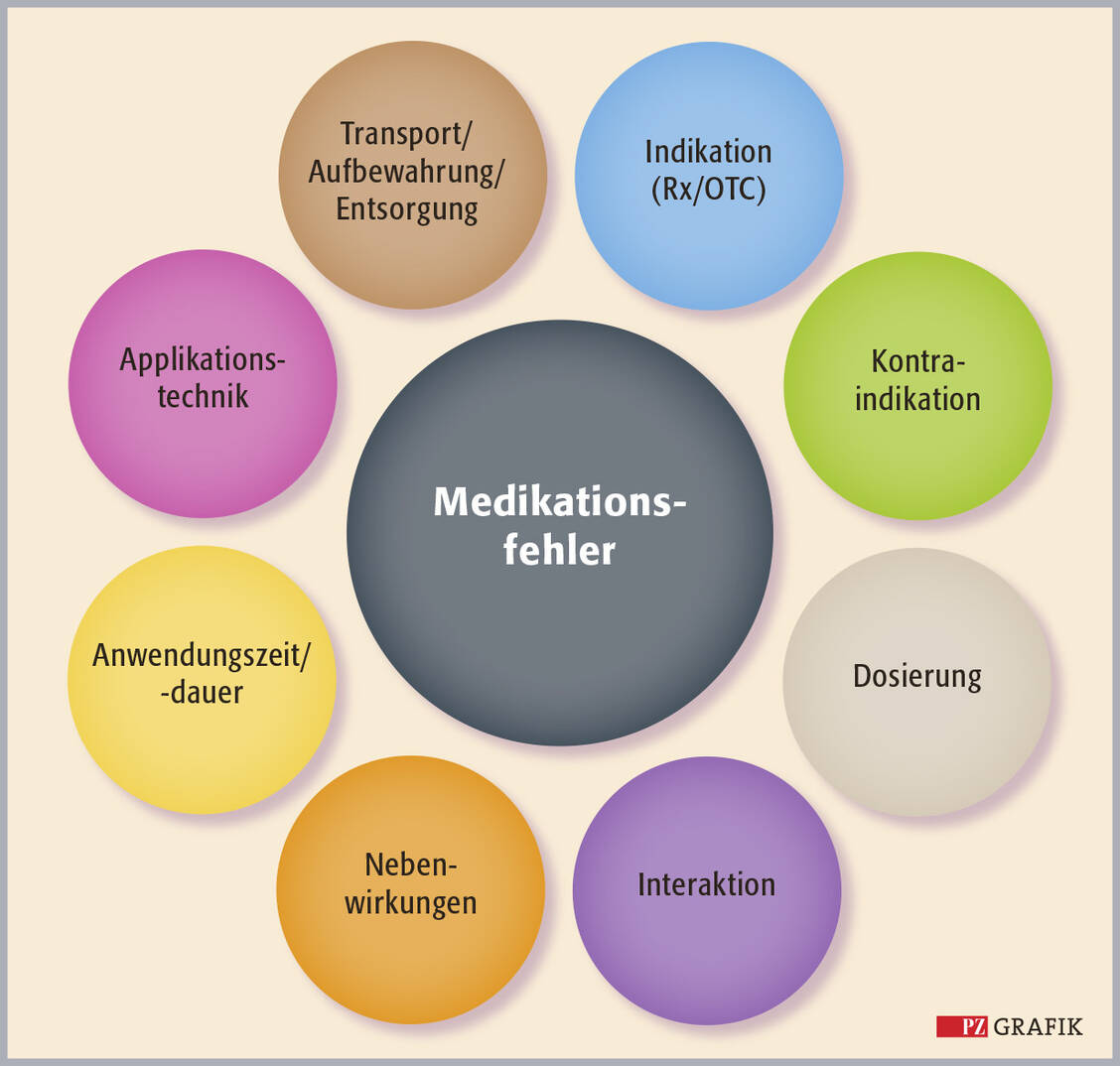Über eigene Fehler zu sprechen und diese zu dokumentieren, um die Fehlerursachen schnellstmöglich zu beseitigen, erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Mitglieder eines Teams. Ein gutes QM-System kann als Bindeglied zum Fehlermanagement und zur Ressourcenplanung für technische Lösungen von fehleranfälligen Arbeits-/Kommunikationsprozessen beziehungsweise Schulungsmaßnahmen fungieren.
Medikationsanalysen, wie sie im Rahmen der pharmazeutischen Dienstleistungen angeboten werden, gehören zu den wichtigsten AMTS-Maßnahmen, um retrospektiv arzneimittelbezogene Probleme, darunter viele Medikationsfehler, aufzudecken und zu verhindern. Das vollumfängliche AMTS-Potenzial entfalten Medikationsanalysen dann, wenn diese wiederholt auf der Basis aktueller Gesundheitsdaten durchgeführt werden (»Medikationsmanagement«).