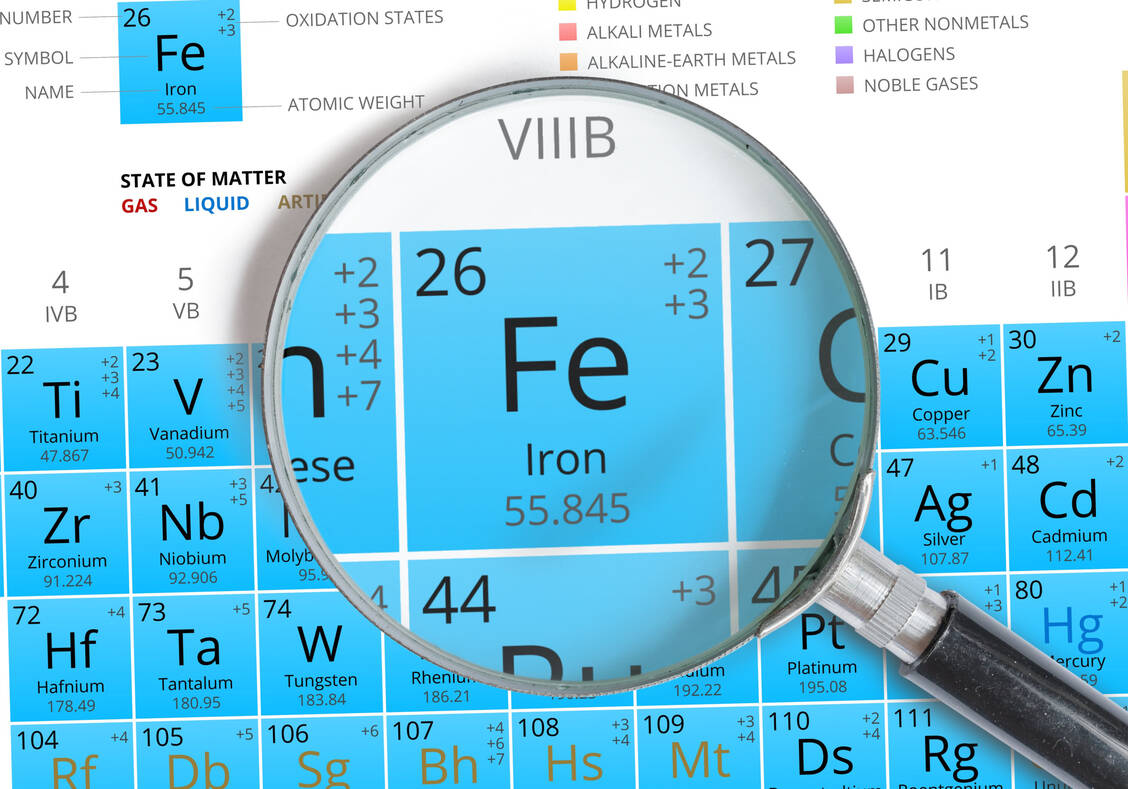Es stellte sich heraus, dass die meisten Teilnehmenden bereits bei Studienbeginn zu niedrige Eisenwerte gehabt hatten, ein Eisenersatz aber in keinem Fall erfolgt war. Der mittels kardialer Magnetresonanztomografie gemessene Eisengehalt im Herzmuskel stieg trotzdem unter der Behandlung mit Empagliflozin signifikant an, nicht aber unter Placebo. Die Änderungen der sogenannten T2*-Relaxationszeiten innerhalb von sechs Monaten korrelierten dabei signifikant mit den Veränderungen der Volumina, der Muskelmasse und der Auswurffraktion der linken Herzkammer, des maximalen Sauerstoffverbrauchs unter Belastung und der Sechs-Minuten-Gehstrecke. Ferner zeigten auch die Laborwerte unter Gliflozin-Therapie eine vermehrte Nutzung von Eisen in den Körpergeweben, zum Beispiel im Herzmuskel, und bei der gesteigerten Neubildung von roten Blutkörperchen.