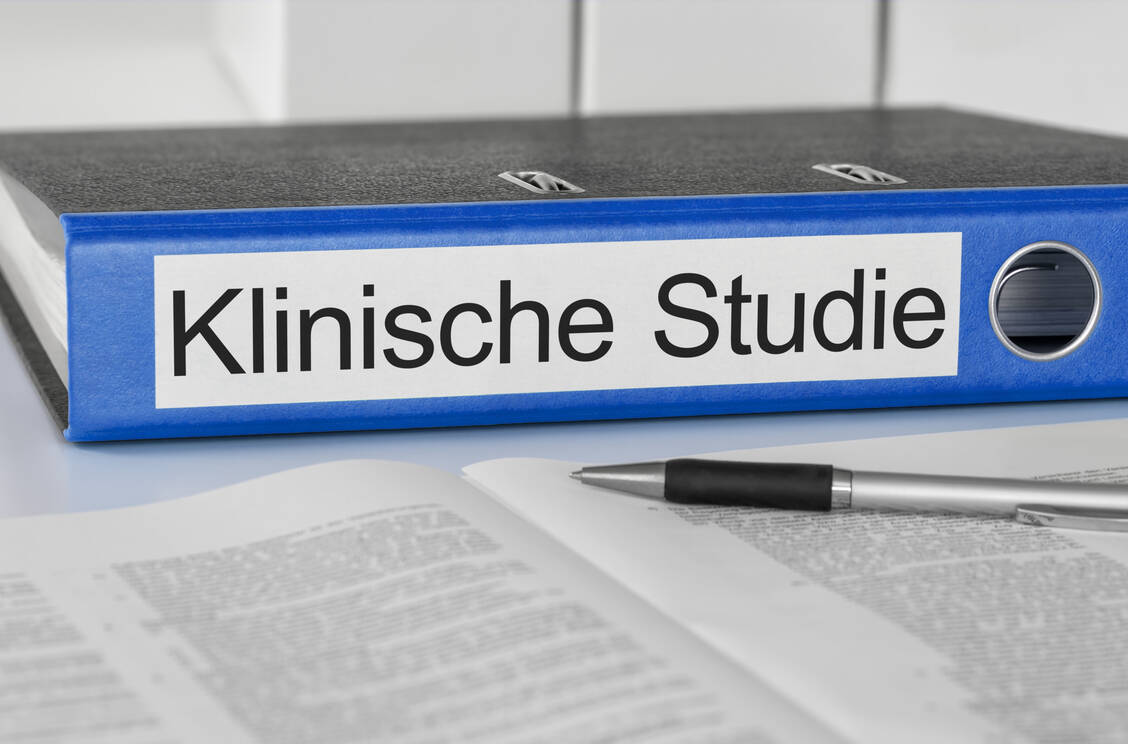Dem IQWiG zufolge sollte sich die EMA ein Beispiel an der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA nehmen. Diese habe in einem im Februar veröffentlichten Leitfaden eine klare Empfehlung für externe Kontrollen ausgesprochen. »Die FDA sagt klipp und klar, dass die Chancen, nur mit einer externen Kontrolle die Wirksamkeit eines Arzneimittels nachzuweisen, nicht gut stehen, und rät nachdrücklich zu einem Studiendesign mit interner Kontrolle – auch für seltene Erkrankungen«, erklärt Dr. Beate Wieseler, Leiterin des IQWiG-Ressorts Arzneimittelbewertung. Die FDA benenne auch konkrete Situationen, in denen extern kontrollierte Studien generell ungeeignet sind, zum Beispiel, wenn der natürliche Verlauf einer Krankheit nicht hinreichend bekannt ist oder stark variieren kann.